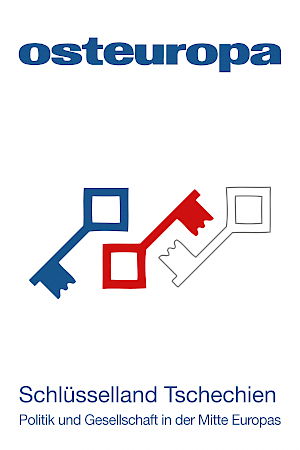Konflikt statt Kampf
Ein Gespräch über Politik und Gesellschaft in Tschechien
Kai-Olaf Lang, Volker Weichsel
Volltext als Datei (PDF, 237 kB)
Abstract in English
Abstract
Tschechien gilt als ein stabiles Land in Ostmitteleuropa. Angriffe auf die Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit, wie sie aus Ungarn und Polen bekannt sind, gibt es in der Tschechischen Republik nicht. Das hat mit der politischen Kultur des Landes, hohem Pragmatismus und schwächer ausgeprägten gesellschaftlichen Gegensätzen zu tun. Doch Tschechien ist auch kein Bollwerk der Demokratie, des Pluralismus und der Rechtsstaatlichkeit. Ministerpräsident Andrej Babiš steht wegen Interessenkonflikten und des Verdachts der Korruption im Visier der EU-Behörden. Und in der Gesellschaft hat sich ein beachtliches Potential an diffuser Unzufriedenheit, Elitenaversion und Misstrauen gegen die staatlichen Institutionen angestaut, das sich in den Wahlen im Herbst 2021 entladen könnte.
(Osteuropa 4-6/2021, S. 91–100)
Volltext
Tschechien gilt als ein stabiles Land in Ostmitteleuropa. Angriffe auf die Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit, wie sie aus Ungarn und Polen bekannt sind, gibt es in der Tschechischen Republik nicht. Das hat mit der politischen Kultur des Landes, hohem Pragmatismus und schwächer ausgeprägten gesellschaftlichen Gegensätzen zu tun. Doch Tschechien ist auch kein Bollwerk der Demokratie, des Pluralismus und der Rechtsstaatlichkeit. Ministerpräsident Andrej Babiš steht wegen Interessenkonflikten und des Verdachts der Korruption im Visier der EU-Behörden. Und in der Gesellschaft hat sich ein beachtliches Potential an diffuser Unzufriedenheit, Elitenaversion und Misstrauen gegen die staatlichen Institutionen angestaut, das sich in den Wahlen im Herbst 2021 entladen könnte.
Osteuropa: Vor Jahren zogen die deutschen Medien ihre Korrespondenten aus Prag ab. Heute berichten sie aus Wien oder Warschau. Was sagt das über Tschechien aus?
Volker Weichsel: Es sagt zunächst etwas über diese Medien aus. Sie müssen sparen und streichen das, was sie für weniger wichtig halten. Polen ist Deutschlands großer Partner und manchmal Rivale im Osten, hat Ambitionen in der EU und Gestaltungsmacht im westlichen postsowjetischen Raum. Wien ist auch 100 Jahre nach Ende des Habsburger Reichs noch immer Drehscheibe für das gesamte Südosteuropa. Tschechien hingegen ist klein und stark nach innen gerichtet. Prag hat weniger Kraft und kaum Willen, die Politik der EU zu gestalten, sucht in Brüssel vor allem seine Nischen, und hat seit der Teilung der Tschechoslowakei 1993 keine Grenze zur Ukraine mehr.
Hinzu kommt das alte Gesetz der Medien: Blood sells. In Tschechien fließt jedoch kein Blut. Kein Bürgerkrieg wie auf dem Balkan in den 1990er Jahren, keine Annexion und keine hybride Intervention. Auch die politischen Kämpfe werden nicht mit der gleichen Härte wie in Polen und Ungarn ausgetragen.
Kai-Olaf Lang: Das stimmt. Die Tschechische Republik ist ein eher unspektakulärer Nachbar. Ob Medien dauerhaft vor Ort sind, entscheiden sie nach eigenen Kriterien: Gibt es eine Notwendigkeit zur intensiven Berichterstattung, weil ständig mit Krisen oder Konflikten zu rechnen ist? Ist das Land aus gesellschaftlichen, wirtschaftlichen oder politischen Gründen besonders relevant? Gibt es sprachliche, kulturelle Gründe oder logistische Standortvorteile, durch die eine Stadt oder ein Land als „Sprungbrett“ für die Berichterstattung aus einer breiteren Region dienen kann. Das alles ist für Tschechien oder Prag kaum gegeben. Es gibt keine innenpolitische Dauerkrise und Instabilität. Keine mächtige Bewegung will die Demokratie umbauen oder liegt im ständigen Streit mit Brüssel. Und die deutsch-tschechischen Beziehungen, in denen noch in den 1990er Jahren historische Fragen wie die Beneš-Dekrete für Gereiztheit sorgten, sind offenbar in eine Phase der kooperativen Normalität übergegangen. Das alles ist schlecht für die Medien, aber gut für die Tschechische Republik.
Osteuropa: Der Fidesz in Ungarn und die PiS in Polen haben illiberale Staaten errichtet: Unter Verweis auf ihre Mehrheit haben sie die Gewaltenteilung unterminiert und die öffentlichen Medien unter ihre Kontrolle gebracht. Checks & Balances sind ihnen ein Greuel. Ähnliches ist aus Tschechien nicht bekannt: Ist Tschechien das Bollwerk der Demokratie, des Pluralismus und der Rechtsstaatlichkeit in Ostmitteleuropa?
Lang: Ob es sich um ein Bollwerk handelt, sieht man erst dann, wenn es gilt, eine Offensive abzuwehren. In der Tschechischen Republik gab es bislang keinen Ansturm auf die liberale Demokratie. Es gab bislang keine vitale Gruppierung, die zielgerichtet Staat, Wirtschaft und Gesellschaft von Grund auf umgestalten wollte.
Weichsel: Das würde ich schärfer formulieren: Ein Bollwerk sieht anders aus. Der Ministerpräsident Andrej Babiš: ein Großunternehmer, der mit den Mitteln seines Konzerns eine ihm ergebene Partei geschaffen hat, um seine wirtschaftlichen Interessen ganz ohne zwischengeschaltete Lobbyisten direkt zu befördern. Der zwei Tageszeitungen gekauft hat und wegen Korruption im Konflikt mit der Europäischen Kommission und der tschechischen Justiz liegt. Der Staatspräsident Miloš Zeman: ein Mann, der polemisiert und polarisiert, Journalisten beschimpft, xenophobe Kampagnen lanciert, in Moskau und Peking Klinken putzt und die oft schwierigen Mehrheitsverhältnisse im Parlament nutzt, um seine Position im politischen System über die ihm von der Verfassung zugewiesene Rolle hinaus auszudehnen.
Lang: Tatsächlich herrscht nicht eitel Sonnenschein. Offenkundig gibt es mächtige private Geschäftsinteressen, die in das Funktionieren des Staates hineinwirken können. Das ist für Nachtransformationssituationen nicht ungewöhnlich. Derlei Interessengruppen und quasi-oligarchische Akteure sind nicht so bedeutsam wie in der Slowakei, wo Finanzgruppen und Unternehmer mit politischen Parteien verquickt waren (oder sind) oder Klientelismus und Bestechung große Teile der Staatsverwaltung durchzogen. Sie haben in der Tschechischen Republik aber ein höheres Gewicht als etwa in Polen. Andrej Babiš ist nur ein Beispiel. Diese Akteure haben nicht den Staat gekapert, aber sie haben auf nationaler wie auch auf regionaler oder lokaler Ebene Netzwerke etabliert, die dafür sorgen, dass ihre Interessen gewahrt werden. Zahlreiche Korruptionsfälle und die Verquickungen zwischen Politik und Business zeugen davon. Denken wir nur an den direkten Draht des Anfang 2021 tödlich verunglückten, bis dahin reichsten Tschechen, des Multimillionärs und Eigentümers der Holding PPF Petr Kellner, zu Staatspräsident Zeman, an die „Kausa OKD“, also die Privatisierung des größten Wohnungsfonds in Ostmitteleuropa, oder an die Verurteilung des früheren Gesundheitsministers und mittelböhmischen Landeshauptmanns David Rath wegen Bestechlichkeit. Die Unstimmigkeiten um das Firmenimperium von Andrej Babiš machen deutlich, wie schwierig es ist, auch in der Tschechischen Republik Transparenz zu schaffen. Im Medienbereich wird ersichtlich, dass die strukturellen, v.a. die schwierigen finanziellen Voraussetzungen es Geschäftsinteressen erleichtern, sich wichtige Outlets zu sichern. Aber: Trotz der Entstehung eines Babiš-nahen Medienkonglomerats und der Präsenz anderer Business-Akteure in der Medienlandschaft wäre es unzutreffend, von einer Einschnürung von Pressefreiheit zu sprechen. Die Säulen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind im Land keineswegs fester als anderswo, sie können sogar korrodieren, aber der große Belastungstest blieb bisher aus.
Weichsel: Konsens. Anders als in Polen und Ungarn gibt es keine organisierte und mächtige politische Kraft, die in der Lage wäre, die legislative und exekutive Macht zu vereinen und die Judikative zu unterjochen. Wie wenig Widerstand die Institutionen des demokratischen Rechtsstaats leisten können, wenn eine politische Kraft mit unbedingtem Willen zur uneingeschränkten Macht über eine klare Mehrheit verfügt und zum Angriff auf diese Institutionen bläst, hat man in Polen und Ungarn gesehen. Das wäre auch in Tschechien kaum anders. Doch die tschechische Gesellschaft ist nicht in gleicher Weise polarisiert und politisiert. Die PiS und der Fidesz führen einen kalten Bürgerkrieg gegen ihre politischen Konkurrenten, die sie als Kommunisten und Verräter der Nation diffamieren. Ministerpräsident Babiš führt seit 2017 eine Regierungskoalition mit den Sozialdemokraten, die bis vor kurzem von der Kommunistischen Partei geduldet wurde – unvorstellbar in Polen und Ungarn.
Das hat etwas mit politischer Kultur zu tun, die historisch bedingt ist. Tschechische Politiker sehen sich gerne als pragmatisch. Das ist nicht nur Stilisierung. Zugespitzt gesagt: In Ungarn und Polen kämpfen Politiker um das Schicksal der Nation, in Tschechien managen sie die Gesellschaft. Diese Depolitisierung kaschiert, dass es natürlich auch in Tschechien um Macht und Einfluss geht. Aber es ist kaum zu bestreiten, dass es in der tschechischen Politik weniger um unverhandelbare Identität als um den Ausgleich von Interessen geht.
Osteuropa: Im Unterschied zu Ungarn, wo Viktor Orbáns Fidesz seit 2010 die Politik dominiert, und Polen, wo die PiS ein stabiles Wählermilieu an sich bindet, ist Tschechiens Parteiensystem volatil und fragmentiert. Was sind die Ursachen?
Lang: Das tschechische Parteiengefüge war lange recht stabil und weltanschaulich klar gegliedert. Seit dem Erstarken der Sozialdemokratie unter Miloš Zeman Mitte der 1990er Jahre bis Anfang des letzten Jahrzehnts prägten Parteien der rechten Mitte und der gemäßigten bzw. fundamentalistischen Linken das Parteiensystem. Im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern in Ostmitteleuropa waren diese Parteien fast alle programmatisch gut zu verorten – zumindest auf den ersten Blick. Es gab europaskeptische Konservative (ODS), europafreundliche Christdemokraten (KDU-ČSL) und Liberalkonservative (ODA, dann US, später TOP 09), eine prowestliche Sozialdemokratie (ČSSD) und die kommunistische KSČM. Diese gefestigt anmutende Struktur konnte sich aber ab einer gewissen Phase nicht mehr reproduzieren. Zuvorderst wohl weil die oberflächlich klare Links-Rechts-Gliederung durch das Paktieren von ODS und Sozialdemokraten, oder genauer ihren damaligen starken Männern, Václav Klaus und Miloš Zeman, unterminiert wurde. Dazu kamen Korruptionsskandale, Innovationslosigkeit der jungen, aber schon etablierten Parteien und ein schleichender Vertrauensverlust in die politischen Eliten. Ein erster Hinweis, dass sich das tschechische Modell erschöpft hatte, zeigte sich bei den Wahlen von 2010, als mit der Gruppierung Öffentliche Angelegenheiten (VV) eine diffuse Protestpartei mit zweistelligem Resultat in das Parlament einzog – die dann aber alsbald wieder verschwand. Danach tauchte Andrej Babiš mit seiner ANO auf.
Seither lassen die Bindekräfte jener Parteien, die schon seit den Gründungswahlen von 1992 präsent sind, kontinuierlich nach. Während sich die rechte Mitte noch behaupten kann, kämpfen Sozialdemokraten und Kommunisten ums Überleben. Im Grunde lassen sich Ent- und Restrukturierungstendenzen in zwei Bereichen beobachten: Die gemäßigte, europafreundliche Wählerschaft der Mitte hat mit der Piratenpartei und der „Bürgermeisterpartei“ STAN vorübergehend ein attraktives Angebot gefunden, bei den Piraten sind eher jüngere und städtische Schichten, bei der STAN eher der mittel- und kleinstädtische Bereich. Die EU- und westkritische Protestwählerschaft zerfasert zunehmend. Andrej Babiš und die ANO erodieren, die KSČM mit ihrer überalterten Anhängerschaft schmilzt ab, nationalistische Akteure wie die SPD oder neue Protestparteien wie die Antikorruptionsbewegung Přísaha absorbieren diejenigen, die antisystemisch orientiert oder von Babiš enttäuscht sind.
Weichsel: In Tschechien sind die gesellschaftlichen Gegensätze, insbesondere die zwischen Zentrum und Peripherie deutlich weniger ausgeprägt. Es gibt keine abgehängten Provinzen, kein starkes Bauerntum. Der Katholizismus ist keine nationale Ideologie, sondern in einem stark säkularisierten Land ein Element von Pluralität. Mit Brno gibt es in Südmähren ein zweites Zentrum, das anders denkt als Prag, Mittelstädte wie České Budejovice oder Olomouc haben sich sehr gut entwickelt, und selbst das nordmährische Ostrava, ein Zentrum der Schwerindustrie, hat den Anschluss geschafft. Alleine das nordböhmische Kohlerevier zwischen Ústí nad Labem und Karlovy Vary ist eine depressive Region. Dort war lange Jahre die Kommunistische Partei stark, heute verzeichnen rechtsradikale Parteien Erfolge – ähnlich wie auf der anderen Seite der durch das Erzgebirge verlaufenden Grenze.
Auch gibt es kein kollektives Trauma, das wie die Trianon-Erinnerung in Ungarn stets zum Zwecke der nationalistischen Mobilisierung reaktiviert werden könnte. Kurzum: Die tschechische Gesellschaft ist individualistischer als die polnische und die ungarische. Will man an einem linearen Geschichtsbild festhalten, könnte man sagen: Sie ist moderner.
Lang: Ich würde drei weitere Faktoren nennen, weshalb es keine tschechische PiS oder Fidesz gibt. Erstens gab es keine starke Führungsfigur, die den Protest von Unzufriedenen hätte integrieren können. Babiš kommuniziert gekonnt, hat aber mit seiner Form der Antipolitik Schwierigkeiten, die Brücke von ganz außen zur Mitte zu schlagen: Er holt radikalisierte Wähler nicht ab und ist für das moderat unzufriedene Zentrum wenig überzeugend. Überdies steht er indirekt in Konkurrenz zu Zeman, von dem er in gewisser Weise abhängt – denn dieser kann ihm angesichts prekärer Mehrheitsverhältnisse im Parlament den Rücken stärken oder ihm durch Personalpolitik unter die Arme greifen oder das Leben schwer machen. Vor allem wird Zeman im Herbst mitmischen, wenn es darum gehen wird, bei möglicherweise unklarem Wahlausgang den Auftrag zur Regierungsbildung zu erteilen. Das Staatsoberhaupt könnte dann erst einmal Babiš damit betrauen und dessen Konkurrenten zumindest eine Weile an den Rand des Geschehens drängen. Zweitens fehlt eine Integrationsideologie mit Zugkraft. Die nationalkonservativen und emanzipatorischen Narrative, die in Polen und Ungarn greifen, verfangen in der tschechischen Gesellschaft nicht. Politiker wie Václav Klaus sen. propagieren zwar auch antiwestliche und souveränistische Haltungen, doch nicht in Form einer großen identitätspolitischen Erzählung. Die Sehnsucht nach Wiederherstellung nationaler Größe, nach Überwindung kollektiver Demütigungen und Tragödien – Volker Weichsel hat zurecht auf Trianon verwiesen – und nach konservativer Wertepolitik sind keine Vehikel zur Mobilisierung der Wählerschaft. Bei Andrej Babiš ging es nie um den Aufbau eines neuen Staatswesens, sondern um konkrete Verbesserungen der Lebenssituation durch eine effektivere Regierungsweise, die behauptet, die Anliegen der einfachen Leute zu verstehen. Babiš mobilisiert nicht mit dem Versprechen einer IV. Republik oder eines konservativen Wohlfahrtstaats wie die PiS oder eines Aufbruchs in ein nichtliberales Gemeinwesen wie im Fall des Fidesz. Säkularität und limitierte Identifikationschancen mit historischer Grandeur oder Tragik machen die Wiederherstellung von Gemeinschaft oder die Akzentuierung von zukunftsstiftender Herkunft wenig hilfreich. Und drittens hat Tschechien keine ähnliche sozioökonomische Erschütterung mit gleichzeitiger Diskreditierung der politischen Klasse erlebt wie Ungarn, wo die Finanzkrise 2006/2008 mit der Skandalrede von Ministerpräsident Gyurcsány zusammenfiel, in der er auf derbe Weise zugab, dass die Regierung die Bevölkerung jahrelang belogen habe.
Dennoch sollte nicht vergessen werden, dass gleichwohl ein beachtliches Potential an diffuser Unzufriedenheit, Elitenaversion und Misstrauen gegenüber „staatstragenden“ Institutionen besteht. Alternative Medien erfreuen sich großer Beliebtheit, Miloš Zeman konnte Mehrheiten hinter sich bringen und wenn wir die Resultate nicht nur der letzten Parlamentswahlen anschauen, so sind Anti-Establishment-Parteien oder politische Contester in der Summe genau so stark wie anderswo im östlichen Mitteleuropa. Die erwähnten strukturellen oder metapolitischen Voraussetzungen machen es nur schwieriger als anderswo, die Nachfrage nach konfrontativer Politik effektiv und nachhaltig zu aggregieren.
Osteuropa: Im Herbst 2021 wählen die Tschechen ein neues Parlament. Wie fällt Ihr Fazit über die amtierende Regierung und Ministerpräsident Babiš aus?
Lang: Die zweite Regierung Babiš und der Ministerpräsident konzentrierten sich vor allem darauf, bestimmte Segmente der Wählerschaft zu bedienen – sei es durch ermäßigte Preise bei Bahnfahrkarten für Senioren und Studenten oder in Form erhöhter Zuwendungen für Eltern. Was weitgehend ausblieb, waren umfassende Reformen im Sozialbereich und die Modernisierung der Verwaltung. Die Klimapolitik ist eher reaktiv, der mögliche Ausstieg aus der Kohle bis zum Jahr 2038 ist bislang nicht von einer offensiven Strategie zum Umbau des Energiesektors begleitet, bei der Kernkraft, die für die tschechische Klimapolitik zentral ist, verzögert sich die Ausschreibung für neue Blöcke des Atomkraftwerks Dukovany. In der Corona-Pandemie hat die Regierung ihre Anfangserfolge verspielt. Sie leistete sich Pannen und Fehleinschätzungen, war nicht fähig, gegen gesellschaftlichen Widerwillen Restriktionen zur Eindämmung des Virus zu ergreifen. Babiš geriet immer mehr in die Defensive: Sein Krisenmanagement gilt als schwach, die Umfragewerte der ANO gingen zurück, sein Tolerierungspartner, die Kommunisten, verließen ihn, sein Koalitionspartner, die Sozialdemokraten, bangen um die Existenz. Der Regierungschef wurde immer abhängiger von Zeman.
Osteuropa: Was ist aus der Protestbewegung „Eine Million Augenblicke für die Demokratie“ gegen Babiš geworden? Im Juni 2019 hatten Hunderttausende Menschen den Rücktritt des Ministerpräsidenten wegen seiner Interessenkollision als Unternehmer, Medienmagnat und Ministerpräsident gefordert.
Weichsel: Böse gesagt: Die Bewegung hatte Vorerkrankungen und ist an Corona gestorben. Mitte November 2019 waren noch einmal 250 000 bis 300 000 Menschen dem Aufruf der Organisatoren gefolgt und auf den Prager Letná-Hügel gekommen. Sie stellten Babiš ein Ultimatum: Er solle bis Ende Dezember seine Anteile am Agrofert-Konzern abgeben und die Justizministerin Marie Benešová entlassen – oder zurücktreten. Babiš dachte überhaupt nicht daran. Er verwies darauf, dass er die Agrofert-Aktien längst zwei Treuhandfonds übergeben habe. Und Benešová – eine enge Vertraute von Präsident Zeman – ist bis heute Justizministerin.
Babiš hat die Protestbewegung einfach ins Leere laufen lassen. Das war möglich, weil sie sehr heterogen war, außer der Forderung nach Rücktritt des Ministerpräsidenten kein klares Programm verfolgte und von einem Team ohne politische Erfahrung koordiniert wurde. Sie hat es geschafft, in einem historischen Augenblick die Sorge von Hunderttausenden Menschen in ganz Tschechien zum Ausdruck zu bringen, dass in Tschechien Ähnliches wie in Ungarn und Polen geschehen könne. Das war für viele Teilnehmer ein sehr bewegender Moment.
Dann kam die Pandemie. Babišs Interessenkonflikte, seine Probleme mit der Justiz verloren an Bedeutung, es gab nur noch ein einziges politisches Thema. Zwar fanden im Sommer 2020 kleinere Aktionen in Prag statt und einem „Online-Protest“ schalteten sich im November 2020 rund 50 000 Menschen zu. Doch das Momentum ist vorbei. Mikuláš Minář, der an der Spitze der Bewegung stand, ist zurückgetreten und mit dem Versuch, eine Partei zu gründen, gescheitert. Sein Nachfolger an der Spitze der Bewegung, Benjamin Roll, hat zwar im April 2021 noch einmal 20 000 Menschen auf den Prager Wenzelsplatz bringen können. Aber über die politische Zukunft der Tschechischen Republik wird nicht auf der Straße entschieden, sondern im Oktober 2021 an den Wahlurnen.
Lang: Das sehe ich ganz ähnlich: Die Pandemie hat die Protestbewegung eingefroren. Massendemonstrationen waren nicht oder nur schwer möglich, und man wollte es nicht den Gegnern der Corona-Schutzmaßnahmen gleichtun, die Großveranstaltungen organisierten. Doch schon zuvor hatten die Organisatoren innegehalten, weil eine Dauermobilisierung auf hohem Niveau nicht möglich war. Als sich die Corona-Lage im Sommer 2021 vorübergehend entspannte, nahm man die Aktivitäten wieder auf. Das Ziel der Initiatoren ist nun, darauf hinzuwirken, dass es im Herbst zu einem Regierungswechsel kommt. Die Lage dieser Protestbewegung ist recht charakteristisch: Nach 1989 bzw. 1993 gab es mehrfach Situationen kurzfristiger Aufwallung. Denken wir an die Initiative „Vielen Dank, tretet ab!“ Ende der 1990er Jahre, die sich gegen das Zusammenwirken von ODS und ČSSD richtete, oder die Demonstrationen gegen die Ausrichtung des öffentlichen Fernsehens zur Jahreswende 2000/2001. All diese Vorstöße verpufften ohne nachhaltige Folgen.
Osteuropa: Auch in Tschechien steht das Verhältnis zwischen nationalstaatlicher Souveränität und supranationaler Einbindung in die EU zur Debatte. Wenn Sie Tschechien mit den souveränistischen Polen und Ungarn vergleichen, wo würden Sie das Land positionieren? Welche Interessen bestimmen Prags Haltung in der EU und zur europäischen Integration?
Lang: Souveränistische Töne sind zwar vereinzelt zu vernehmen, doch in der Prager Europapolitik bleiben sie eher folgenlos. Prag grenzt sich europapolitisch in vielen Fragen von Warschau und Budapest ab und versucht sich als pragmatischer Akteur zu profilieren. Prag hat keine Vertragsverletzungsverfahren durch Brüssel an der Backe, verficht keine Kulturkämpfe, legt keine Vorschläge zur Reform der EU vor, die auf eine Repatriierung von Kompetenzen im Sinne eines Europas der Vaterländer abzielen. Prag möchte in der EU einen funktionierenden Binnenmarkt, effektive, aber nicht extensiv „politisch“ definierte supranationale Institutionen und eine außenpolitisch handlungsfähige, transatlantisch eingebundene europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Die harten Souveränisten à la Václav Klaus sen. und jun. werden keinen prägenden Einfluss auf die Europapolitik erhalten. Sollte die ODS, die sich selbst als eurorealistisch bezeichnet, an der Regierung beteiligt sein, so wird sie von anderen Gruppierungen eingehegt sein. Überdies ist die Partei unter ihrem Vorsitzenden Fiala gerade europapolitisch deutlich pragmatischer geworden als in früheren Jahren.
Weichsel: Konsens mit Einschränkungen. Vorab: Weder Polen noch Ungarn sind souveränistisch. In Warschau gibt es eine starke Tradition, in der europäischen Politik mitzumischen. Diese reicht bis weit in die PiS hinein. Dies wird gegenwärtig davon überlagert, dass die Europäische Kommission zurecht das Vorgehen der PiS gegen die unabhängige Justiz kritisiert und so zum Akteur der polnischen Innenpolitik geworden ist. Ähnlich Ungarn. Die Wiedervereinigung der ungarischen Nation in einem Europa ohne Grenzen war ein Kernanliegen der ungarischen Politik und das Verhältnis zu Deutschland als zentralem Staat der EU stets unbelastet. Das hat sich erst durch die Kritik der EU-Institutionen am autoritären Umbau des politischen Systems in Ungarn geändert. Mittlerweile provoziert Orbán gezielt Konflikte mit der EU, um die Bedrohung angeblicher Werte zu demonstrieren und so seine Anhänger zu mobilisieren.
In Tschechien ist es umgekehrt. Schon im 19. Jahrhundert gab es in der tschechischen Politik eine Strömung, deren Motto war: „Lieber König in Prag als beim Kaiser in Wien bloß am Tisch“. Nach dem Münchner Vertrag von 1938, in Tschechien oft „Verrat von München“ genannt, und der anschließenden Zerstückelung und bald auch Besetzung der Tschechoslowakei durch das nationalsozialistische Deutschland galt die Sowjetunion 1945 vielen Tschechen als Befreier. Das ist eine ganz andere Situation als in Polen, einem Opfer des Hitler-Stalin-Pakts, oder Ungarn, einem Verlierer des Zweiten Weltkriegs. Erst die Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 brachte eine Wende. Doch der bekannte Spruch über den Umbruch von 1989 „Polen – zehn Jahre, Ungarn – zehn Monate, DDR – zehn Wochen, Tschechoslowakei – zehn Tage“ besagt ja vor allem, dass nirgendwo im kommunistischen Ostmitteleuropa die Anhänger der alten Ordnung – der inneren wie der geopolitischen – so stark waren wie in Prag.
Das setzte sich nach 1989 fort. Nur in Tschechien überlebte eine nahezu unreformierte Kommunistische Partei mit starker Mitgliederbasis und einem konstanten Wähleranteil von über zehn Prozent. Und es ist kein Zufall, dass Tschechien als letzter aller ostmitteleuropäischen Staaten erst 1995 den Antrag auf Beitritt zur Europäischen Union gestellt hat. Der damalige Ministerpräsident Václav Klaus ist später zu einem europaweit bekannten EU-Kritiker geworden. Als Präsident beging er den Beitritt zur EU im Mai 2004 als Trauertag, als Tag des Verlusts der nationalen Souveränität. Viele meinen, er hätte sich erst im Laufe der Jahre zum EU-Skeptiker gewandelt. Tatsächlich aber hatte er bereits 1992 in einem programmatischen Aufsatz melancholisch von der britischen Insellage geschwärmt. Und wenn er in den 1990er Jahren gebetsmühlenartig wiederholte, Tschechien sei ein „westlicher Standardstaat“, so bedeutete dies vor allem, dass er sich dagegen verwahrte, dass Tschechien vor dem Beitritt zur EU seine Rechtsordnung an den acquis communautaire anpassen müsse. Dass Tschechien – trotz Erfüllung der Maastricht-Kriterien – anders als die Slowakei nicht der Eurozone beitreten will, ist Ausdruck einer Zurückhaltung, die weit über die ideologisierten Kreise hinausreicht.
Und doch ist Prags Verhältnis zur EU heute viel besser als das Warschaus und Budapests. Grund ist die innenpolitische Situation. Es gibt hier keinen Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz, die Pressefreiheit, die Wissenschaftsfreiheit und die Minderheitenrechte: kurzum keinen Konflikt um die Anerkennung der Grundwerte der EU. Die Ermittlungen der Europäischen Kommission gegen Babiš haben allerdings das Potential, eine Eskalation zu bewirken. Die Kommission hat in einem Anschlussbericht vom Oktober 2020 bestätigt, dass sie der Ansicht ist, Babiš kontrolliere weiter den Agrofert-Konzern, so dass ein Verstoß gegen die Regeln zur Vermeidung von Interessenkonflikten bestehe. Zudem bereitet die Kommission einen zweiten Untersuchungsbericht vor, in dem es nicht wie im ersten um Zahlungen an Agrofert aus dem Struktur- und Regionalfonds, sondern um solche aus dem viel größeren Agrarfonds geht. Sollte Babiš im Herbst wiedergewählt werden, wird dieser Konflikt in eine neue, heißere Runde gehen.
Dennoch vertritt Prag vor allem tschechische Interessen in der EU und nicht die Interessen der herrschenden Partei gegen die EU. Oft sind die tschechischen Positionen gemäßigt. Lediglich in der Frage der Verteilung von Flüchtlingen in der gesamten EU zur Entlastung Griechenlands und Italiens nahm Prag im September 2015 eine harte Haltung ein und votierte mit der Slowakei, Ungarn und Rumänien gegen eine solche Verteilung. Trotz einer Verurteilung durch den Europäischen Gerichtshof weigert sich Prag bis heute, den betreffenden Beschluss umzusetzen. Insgesamt ist Tschechien aber selten in einer solchen explizit „osteuropäischen“ Gruppe. Viel häufiger decken sich die Positionen mit denen Deutschlands, etwa in Fragen des EU-Haushalts. Prag gehört weder zu den Anhängern einer umfangreichen Subventionspolitik, noch fordert man eine strenge Austeritätspolitik. Auch zu Nord Stream 2 vertritt die tschechische Regierung eine ähnliche Haltung wie Berlin. In einer anderen energiepolitischen Frage, die Prag sehr wichtig ist, gehen die Positionen jedoch auseinander und Tschechien wird eher in Paris Partner finden: der Anerkennung der Atomkraft als klimafreundliche und daher förderwürdige Technologie.
Osteuropa: Welche Bedeutung misst Tschechien der Visegrád-Gruppe zu? Wo engagiert sich Prag besonders? Welche Handlungsfelder haben Substanz? Und wie beurteilen Sie die Funktion der Visegrád-Gruppe?
Weichsel: In den 1990er Jahren mied Tschechien unter Václav Klaus die Visegrád-Gruppe, weil er in ihr eine Art Katzentisch für unreife „Oststaaten“ sah. In den 2000er Jahren entwickelte sich die Gruppe zu einem regen Forum für regionale Kooperation in Ostmitteleuropa, in dem die vier teilnehmenden Staaten auch ihre Interessen im Rahmen der EU abglichen. In den 2010er Jahren versuchte zunächst Ungarn, ab 2015 dann auch Polen, die Gruppe zu einem Bollwerk gegen Einmischung der EU in vermeintlich „innere Angelegenheiten“ zu machen. Dem steht Prag in der Regel skeptisch gegenüber. Mit der polnischen Vorstellung einer Nord-Süd-Achse unter Warschauer Führung (Drei-Meere-Initiative) kann man in Tschechien wenig anfangen. Und zu Orbáns Hilfsprellbock in seiner Fehde mit der EU-Kommission will sich in Prag auch keiner machen lassen. Tschechien nimmt an den Regierungskonsultationen im Rahmen der V4-Gruppe teil, sucht Interessenüberschneidungen, vermeidet aber, sich radikalen Positionen aus Warschau oder Budapest anzuschließen. Mehrfach hat es sich mit Enthaltungen aus der Affäre gezogen, wenn Polen oder Ungarn ein gemeinsames Veto bei EU-Beschlüssen anstrebten.
Lang: Visegrád ist für die Tschechische Republik ein wichtiger Bezugsrahmen, ein selektiver europapolitischer Kraftverstärker, ein Forum für regionale Kooperation von außen- und europapolitischen bis zu „weichen“ Formen der Zusammenarbeit etwa der Zivilgesellschaft oder auf dem Gebiet der Kultur. Gleichwohl ist man bemüht, Visegrád nicht als dominantes Kooperationsformat zu pflegen. Tschechien und auch die Slowakei wollen beide nicht mit Polen und Ungarn identifiziert werden. Prag unterstreicht immer wieder, wie wichtig ihm die Beziehungen zu Deutschland seien, und betont, dass Visegrád nicht als Gegengewicht zu Deutschland verstanden werden darf. Prag wirkt übrigens auch an anderen regionalen Kooperationsforen mit. Mit Österreich und der Slowakei kooperiert man in der auf Projekte regionaler Zusammenarbeit und gegenseitige europapolitische Information ausgerichteten Austerlitz-Initiative; mit diesen beiden Ländern, Ungarn und Slowenien in der noch jungen Central Five, einer lockeren Konsultationsrunde, die im Frühsommer 2020 zur besseren Abstimmung in Fragen der Grenzregime und generell der Pandemiepolitik einberufen wurde, die aber auch zu außen- und europapolitischen Fragen Stellung nimmt.
Osteuropa: Wie beurteilen Sie Tschechiens Russlandpolitik? Welche Auswirkungen haben die geschichtspolitischen Konflikte zwischen Prag und Moskau um Denkmäler und Straßennamen sowie der Skandal um die Explosion in einem Waffenlager in Südmähren, für den Prag den russländischen Militärgeheimdienst GRU verantwortlich macht?
Weichsel: Die Russlandpolitik ist ein Thema, das Tschechien polarisiert. Teile der Gesellschaft haben trotz der Krim-Annexion 2014 und der Entfesselung des Kriegs im Donbass, die sie sehr an die Ereignisse des Jahres 1938 erinnern müssten, weiter ein positives Bild vom heutigen Russland. Dies ist besonders stark am linken und rechten Rand des politischen Spektrums. Das positive Bild von Russland geht mit antidemokratischem Denken, Antiamerikanismus, großen Vorbehalten gegen Deutschland und die Deutschen sowie einer grundsätzlichen Ablehnung der Mitgliedschaft Tschechiens in der Europäischen Union einher. Gallionsfigur der tschechischen Querfront-Kremlversteher ist Präsident Miloš Zeman. Auch manche Industriekreise versuchen immer noch, die Augen vor der Willkürherrschaft des Putin-Regimes zu verschließen.
Exemplarisch war der jahrelang schwelende Streit um die Zulassung des russländischen Atomunternehmens Rosatom als möglicher Technologielieferant für den geplanten neuen Reaktorblock im Atomkraftwerk Dukovany. Zeman und ihm nahestehende Unternehmer mit guten alten Kontakten nach Russland setzten sich stets dafür ein. Die Hoffnung war, tschechische Firmen könnten in diesem Fall als Zulieferer einen größeren Teil des Kuchens abbekommen, als dies bei einem westlichen Technologielieferanten der Fall wäre.
Während die geschichtspolitischen Auseinandersetzungen keinerlei Veränderungen gebracht, sondern nur die innertschechischen Fronten verhärtet haben, hat die Nachricht, dass hinter den zwei Explosionen in einem südmährischen Munitionsdepot im Jahr 2014 mutmaßlich der russländische Militärgeheimdienst steht, eingeschlagen wie eine Bombe. Die Regierung Babiš hatte zuvor stets versucht, eine leise, wirtschaftsnahe Russlandpolitik zu betreiben. Kein nationaler Befreiungskampf wie in Polen und kein an die EU gerichtetes Drohen mit Russland als Alternative wie in Ungarn. Doch die Beweise, die der tschechische Verfassungsschutz zu den Explosionen vorlegte, müssen schlagend sein, sonst hätte Babiš nicht die Nachricht in einer abendlichen Sondersitzung verkündet. Die Regierung verwies umgehend 18 Mitarbeiter der russischen Botschaft des Landes und strich Rosatom von der Liste möglicher Technologielieferanten. Moskau reagierte mit gespielter Empörung und brachte mit der Ausweisung tschechischer Diplomaten die Botschaft in Moskau an den Rand der Arbeitsunfähigkeit. Der Kreml hat es geschafft, die tschechisch-russischen Beziehungen zu vergiften und seine Fürsprecher in Prag in die Defensive zu bringen. Tschechien holt den schmerzhaften Prozess der Einsicht in das Wesen des Putin-Regimes nach, den auch die deutsche Gesellschaft durchgemacht hat. Nur Zeman sieht weiter ein Komplott.
Osteuropa: Wie schaut die tschechische Öffentlichkeit auf Deutschland? Mit welchen Begriffen würden Sie die deutsch-tschechischen Beziehungen charakterisieren?
Lang: In der tschechischen Öffentlichkeit besteht nach wie vor eine Mischung aus Bewunderung und Skepsis: Bewunderung, weil Deutschland wirtschaftlich der positive Bezugspunkt ist und weil in Deutschland ein effizienteres Regieren, ein professionellerer Staatsapparat, glaubwürdigere Eliten erblickt werden. Auch schreibt man Berlin eine wirksamere Europa- und Außenpolitik zu als der eigenen Regierung – nicht nur, weil Deutschland größer ist, sondern auch weil man den eigenen Repräsentanten weniger Expertise zuschreibt. Deutschland ist insofern weiterhin Vorbild. Skepsis, weil es in Teilen der tschechischen Gesellschaft Zweifel an den außen- und europapolitischen Zielen und Handlungsformen Deutschlands gibt. Die Europaskeptiker hegen Dominanzängste, die Nationalisten kultivieren alte Aversionen und die Transatlantiker befürchten, Deutschland könne auf Distanz zu Washington gehen und zu Alleingängen in Sachen Russland neigen. Dennoch sind die deutsch-tschechischen Beziehungen in einem außerordentlich guten Zustand. Sehen wir einmal von der Erregung um Grenzschließungen und die Differenzen in der Migrationspolitik ab, verhält sich das Bilaterale recht harmonisch – verglichen mit den deutsch-polnischen Beziehungen oder auch den deutsch-tschechischen bzw. -tschechoslowakischen Beziehungen in der Vergangenheit. Was die politischen Beziehungen im engeren Sinne angeht, so gibt es zahlreiche Überlappungen und ein dichtes Netz an Kontakten. Mit dem Strategischen Dialog der beiden Regierungen wurde ein ambitioniertes Koordinations- und Kooperationsgeflecht etabliert, das es in der Form zwischen EU-Staaten nur selten gibt. Sucht man nach einer begrifflichen Fassung, so könnten die deutsch-tschechischen Beziehungen als kooperatives Nah- und Mehrebenenverhältnis mit hohem Ambitionsniveau bei fortbestehenden Partnerschaftsasymmetrien und konfliktträchtigen Partialdifferenzen beschrieben werden.
Osteuropa: Vielen Dank!
Die Fragen stellte Manfred Sapper.
Volltext als Datei (PDF, 237 kB)