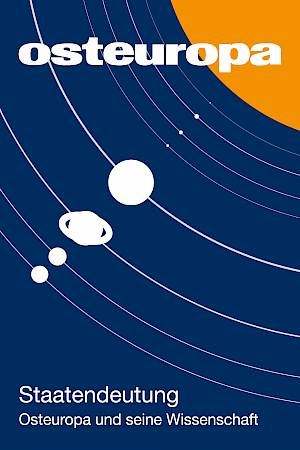Politikberatung und ihre Grenzen
Lehren aus drei Jahrzehnten Osteuropaforschung
Volltext als Datei (PDF, 328 kB)
Abstract in English
Abstract
In einer komplexen Welt hat die Politik ständig Bedarf an validen Informationen und Wissen, um Probleme zu erkennen, Lösungen zu entwickeln und Entscheidungen zu treffen. In Entscheidungsprozessen greifen Politik und Verwaltung auf die Wissenschaft zurück. Doch der Wissenstransfer ist anspruchsvoll und gelingt nur unter spezifischen Bedingungen. Eine subjektive, auf teilnehmender Beobachtung und persönlichen Erfahrungen basierende Reflexion über die Chancen und Grenzen der wissenschaftlichen Politikberatung in der regionalen Außenpolitikforschung ergibt: Der Beitrag der Osteuropaforschung zur deutschen Außenpolitik gegenüber Russland ist höchst begrenzt, wie sich an der Tschetschenienpolitik, der NATO-Osterweiterung, der Modernisierungspartnerschaft und der Frage nach einer neuen Sicherheitsarchitektur in Europa gezeigt hat. Zu stark unterscheidet sich die Handlungslogik von Wissenschaft und Politik.
(Osteuropa 1-2/2020, S. 141–164)
Volltext
In einer komplexen, sich dynamisch verändernden Welt benötigt Politik umfassende Information, die es ihr erlaubt, zeitnah Probleme zu erkennen, Lösungswege zu erarbeiten und Entscheidungen zu treffen. Insofern stützen sich politische Entscheider auf Stäbe, die das verfügbare Wissen aufbereiten und bereitstellen und die ihrerseits auf den Input aus dem Staatsapparat, den Lobbyverbänden, den Medien und eben auch der Wissenschaft angewiesen sind. Gerade von der Wissenschaft erwartet man eine sachorientierte, nicht von Interessen geleitete Beratung. Wissenschaft ist im Grundsatz den eigenen theoretischen und methodischen Ansätzen verpflichtet, sie vermehrt Wissen, hat aber in diesem Rahmen auch einen gesellschaftlichen Auftrag, ihre Einsichten Gesellschaft und Politik zugänglich zu machen.
Max Weber hat in den Jahren 1917 und 1919, während des Zerfalls des Kaiserreichs und des Übergangs zur Republik, die Besonderheiten von Politik und Wissenschaft in zwei Vorträgen herausgearbeitet.[1] „Die praktisch-politische Stellungnahme und wissenschaftliche Analyse politischer Gebilde und Parteistellungen ist zweierlei“, stellt er darin fest.[2] Politik definiert er als "Streben nach Machtanteil oder nach Beeinflussung der Machtverteilung, sei es zwischen Staaten, sei es innerhalb eines Staates zwischen den Menschengruppen, die er umschließt".[3] Daraus ergibt sich auch das, was nach Weber das Wesen eines Politikers ausmacht:
"Wer Politik treibt, erstrebt Macht: – Macht entweder als Mittel im Dienst anderer Ziele (idealer oder egoistischer), – oder Macht „um ihrer selbst willen“: um das Prestigegefühl, das sie gibt, zu genießen."[4]
Das Handeln des Politikers soll aber einem Sinn folgen, es muss Dienst an einer Sache sein. Welchen Sinn, welche Sache ein Politiker verfolgt, ist aber – so Weber – „Glaubenssache“.[5] Insofern trifft die Politik Wertentscheidungen, die in politisches Handeln umgesetzt werden. Weber unterscheidet zwischen einem gesinnungsethischen Ansatz, der das Handeln allein an der gewählten weltanschaulichen Maxime misst, und einem verantwortungsethischen, dem bewusst ist, dass der Entscheider auch für die Folgen seines Tuns einzustehen hat.[6]
Die Aufgabe von Wissenschaft sieht Weber anders: Sie setzt sich als „fachlich betriebener Beruf“ mit menschlichem Handeln auseinander, entwickelt zu seiner Analyse das gedankliche Handwerkszeug und verschafft auf diese Weise „Klarheit“, indem sie die Mittel an die Hand gibt, Voraussetzungen und Konsequenzen von Entscheidungen sachgerecht zu analysieren.[7] Mit dieser Unterscheidung zwischen „Politik“ und „Wissenschaft“ steckte er das Feld für wissenschaftliche Politikberatung ab. „Wertentscheidungen“, also die Bestimmung der politischen Ziele, trifft die Politik, Wissenschaft stellt ihr die fachlich gesicherten Informationen zur Verfügung, die notwendige Voraussetzung ist für verantwortbares Handeln.[8]
Mit welchen Problemen wissenschaftliche Politikberatung konfrontiert ist, wurde in der Literatur schon vielfach behandelt.[9] Wenn das Thema hier dennoch aufgegriffen wird, dann geschieht das, um die spezifischen Erfahrungen im Bereich der Osteuropaforschung zu beleuchten. Es geht dabei um Außenpolitikberatung, genauer: um Außenpolitikberatung mit regionalem Schwerpunkt. Diese Arbeit unterscheidet sich in mancher Hinsicht von der anderer Wissenschaftler, die sich mit innen-, wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Fragen befassen. Parteienforscher, Wahlforscher, Demographen oder die „Wirtschaftsweisen“ haben andere Methoden und behandeln Themen, die Politik und Medien näher liegen. Das gilt noch mehr für die Fachleute aus den Naturwissenschaften, den Ingenieurwissenschaften, der Informatik oder der Medizin, auf deren Expertise Politik in der technologisierten Welt von heute dringend angewiesen ist.[10] Die Corona-Pandemie von 2020 zeigt, welche Bedeutung wissenschaftliche Beratung in Krisenzeiten hat, wenn die Politik darauf angewiesen ist, dass die Wissenschaft – in diesem Fall die Medizin – ihr Lösungswege vorzeichnet.
Die Rolle von Außenpolitikforschung ist durchaus bescheidener, zumal wenn sie sich nur mit einem Teilaspekt der internationalen Politik befasst. Osteuropaforschung ist Regionalforschung. Und Regionalforschung[11] setzt sich stets mit einem „Einzelfall“ auseinander, eben mit der jeweiligen Region. Diese bearbeitet sie nicht nur aus dem Blickwinkel einer einzelnen Disziplin, sondern sie untersucht den Fall, indem sie die Sichtweisen und Methoden verschiedener Disziplinen (Rechtswissenschaften, Geschichte, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften, Geographie, Demographie oder Politologie) verbindet. Sie nutzt eine multidisziplinäre Herangehensweise, um die Entwicklungen in einer Region zu erfassen und zu erklären. Indem Regionalforschung so konkrete, fallbezogene Problemanalyse betreibt, erbringt sie eine Analyseleistung, die den Bedürfnissen politischer Entscheider in mancher Hinsicht entgegenkommt. Osteuropa- und Russlandpolitik war und ist in Deutschland ein relevantes Thema. Während des Ost-West-Konflikts bis 1989 sowie in der Phase des Übergangs Anfang der 1990er Jahre war Expertise in diesem Feld stark nachgefragt. Angesichts der Russland-Ukraine-Krise besteht auch seit 2014 wieder ein gestiegener Bedarf an einschlägigem Fachwissen.
Osteuropaforschung war in Deutschland von Anfang an ein Fach, das sich politisch verstand und von der Politik in Dienst genommen wurde. Ansprechpartner für Osteuropaforscher sind die Fachreferate im Auswärtigen Amt, im Kanzleramt, im Verteidigungsministerium und in den anderen Ressorts, die sich mit dem östlichen Europa befassen, sowie die Handvoll Abgeordnete, die sich für Osteuropa interessieren. Dazu kommen Verbandsorgane wie der „Ostausschuss“ der deutschen Wirtschaft und NGOs, die in Osteuropa engagiert sind wie der Deutsch-Russische Austausch oder der Europäische Austausch. Das ist in der Bundesrepublik ein überschaubarer Kreis. Bei Themen wie „Klimaschutz“, „Dieselkrise“ oder „Energiewende“, die von globaler Bedeutung sind, bei denen neben der Bundesebene auch Länder und Kommunen sowie Großunternehmen, Wirtschaftsverbände und Umweltschutzorganisationen involviert sind und bei denen die Expertise von Naturwissenschaftlern und Ingenieuren relevant ist, stellt sich die Lage durchaus anders dar. Die Zahl der betroffenen Institutionen und Organisationen ist dort weitaus größer, der Bedarf an Orientierungswissen wird deutlicher wahrgenommen und die materiellen Einsätze, um die es den interessierten Seiten geht, sind in der Regel viel höher. Dementsprechend ist das Medieninteresse groß. Das ist im Bereich der Osteuropaforschung nur der Fall, wenn es um akute Krisen wie die Annexion der Krim, den Krieg in der Ostukraine, den Abschuss der MH-17-Passagiermaschine über dem Kriegsgebiet oder das Ende des INF-Vertrags geht. In „ruhigen Zeiten“ ist der Kreis der an Osteuropa Interessierten begrenzt.
Wissenschaftliche Analyse und politisches Geschäft: Eigene Erfahrungen
Der Verfasser war von 1986 bis 2016, also drei Jahrzehnte, in verschiedenen Institutionen der politikbegleitenden Forschung tätig.[12] Die Arbeit in wissenschaftlichen Instituten, die ihre Informationen Politik und Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, besteht zunächst in normaler Forschungstätigkeit. Der Unterschied zur Universität ist am ehesten in der Themenwahl erkennbar. Orientiert sich die akademische Forschung an der Debatte in der eigenen Disziplin, die sie weiterentwickeln will, gewinnt die politikbegleitende Forschung ihre Themen aus der politischen Entwicklung, die sie erklären und im Idealfall sogar antizipieren will. Unterschiede gibt es auch in der Darstellung der Forschungsergebnisse: Schreibt man an der Universität in erster Linie für die Fachkollegen und gibt sich auch durch die Übernahme der Fachsprache als Wissenschaftler zu erkennen, wendet sich die politikbegleitende Forschung an Nichtfachleute und ist gehalten, auch komplexe Sachverhalte knapp und verständlich zu formulieren. Die Konzentration auf politikrelevante Fragen und die klare Darstellungsweise heißt aber nicht, dass politikbegleitende Forschung die Theorien und Methoden ihrer jeweiligen Disziplin ignoriert. Denn darin erweist sich die Wissenschaftlichkeit der Arbeit, die den Forscher legitimiert, Ratschläge zu geben.
Beratungsnetzwerke
Ein wesentliches Element von politikbegleitender Forschung und Politikberatung ist der fortgesetzte Austausch mit den „Praktikern“. Der Kontakt zu Politik und Medien, die Entwicklung von Kontakten in den Ressorts, den Fraktionen, den Stiftungen der Parteien, in Medien und Verbänden ist eine Voraussetzung für Beratungsarbeit. Die Entwicklung eines Netzwerks von Kontakten ergibt sich meist aus der eigenen Forschungsarbeit und hat entsprechend einen spezifischen, von der persönlichen Tätigkeit bestimmten Charakter. Für mich ergaben sich viele Kontakte aus Beiträgen in den Publikationen des BIOst oder später in den Russland-Analysen, auf die Journalisten, Mitarbeiter aus dem Bundestag oder den Ministerien reagierten. Manche Verbindungen entwickelten sich, wenn ehemalige Studenten oder Projektmitarbeiter ihren Weg in die operative Politik oder in die Verwaltungen machten. Viele Kontakte resultierten aus Tagungen und Konferenzen, vor allem aus den Gesprächsrunden des BIOst, aber auch aus den verschiedenen Osteuropa-Runden, die in den 1980er Jahren im Bonner Raum stattfanden. Dazu gehörten der „Arbeitskreis für Ost-West-Fragen“, der Beamte des Auswärtigen Amtes und des Kanzleramts, Offiziere des Verteidigungsministeriums und Experten zusammenführte, oder Veranstaltungen der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO), vor allem die Redaktionskonferenzen von Osteuropa in der „Winterscheider Mühle“, die sich dadurch auszeichneten, dass es keine Referate gab, sondern nur eine strukturierte Diskussion.[13] Ein anderes Format, das Experten, Offiziere und Ressortvertreter zusammenbrachte, war der „Arbeitskreis Russische Außen- und Sicherheitspolitik“ (AK RASP), der Ende der 1980er Jahre von der Akademie der Bundeswehr für Psychologische Verteidigung (AkPSVBw bzw. AIK)[14] und dem BIOst gemeinsam organisiert wurde. Der Arbeitskreis traf sich einmal im Jahr in Waldbröl, um zwei Tage lang Szenarien zur sicherheitspolitischen Entwicklung in Osteuropa durchzuspielen. Die halbtägigen Sitzungen des „Arbeitskreises Russische Außen- und Sicherheitspolitik“ der SWP sind eine späte Fortsetzung dieses Formats. Möglichkeiten zum Austausch boten auch Veranstaltungen wie die Tagungen des Nachrichtenwesens der Bundeswehr in Bad Ems, die bis weit in die 1990er Jahre hinein vorwiegend dem Ost-West-Konflikt gewidmet waren. Lehrreich war die Begleitung von Bundestagsabgeordneten auf Reisen in die Sowjetunion bzw. nach Russland, wodurch sich die Gelegenheit ergab, die Büros von Gorbačev-Beratern im Kreml und der Internationalen Abteilung des Zentralkomitees am Staraja ploščadʼ kennenzulernen. Als die KSZE im Februar 1990 und im Oktober 1991 in der Wiener Hofburg Militärdoktrinenseminare durchführte, stellte mich das BIOst für mehrere Wochen dem Auswärtigen Amt zur Verfügung, so dass ich als Delegationsmitglied Erfahrungen sammeln konnte. Ähnliche Möglichkeiten bot die Teilnahme am „Petersburger Dialog“ in St. Petersburg 2008, in München 2009 und in Ekaterinburg 2010 sowie am Valdaj-Club 2009 und 2011, der von der Nachrichtenagentur RIA Novosti und dem Sovet po vnešnej i oboronnoj politike (Rat für Außen- und Verteidigungspolitik, SVOP) organisiert wird. Eine wichtige Rolle spielten die Parteienstiftungen, die in vielen osteuropäischen Ländern Außenstellen haben und gern den Kontakt mit Experten halten. In ihren Veranstaltungen führen sie Politiker und Experten aus Deutschland und Russland zusammen. Hervorzuheben sind hier die „Schlangenbader Gespräche“, welche die Moskauer Vertretung der Friedrich-Ebert-Stiftung mit der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung seit 1998 durchführt, und die dabei mit der Moskauer Vertretung der Konrad-Adenauer-Stiftung, dem Institut für Weltwirtschaft und Internationale Beziehungen der Russländischen Akademie der Wissenschaften (IMĖMO) kooperieren.[15]
Diese Aktivitäten boten die Möglichkeit, sich national und international zu vernetzen, Gesprächspartner aus Wissenschaft, Medien und Politik zu finden, Erfahrungen zu sammeln und Vertrauen aufzubauen. Insbesondere Vertrauen ist für die Politikberatung wichtig, denn es verschafft dem Wissenschaftler Zugang zu den Apparaten und sorgt dafür, dass seine Expertise als glaubwürdig wahrgenommen wird.
In dem geschilderten Rahmen boten sich viele Möglichkeiten für den Austausch von Informationen und Meinungen. Das war fortgesetzte informelle Politikberatung, von der beide Seiten profitierten. Wie wissenschaftliche Information, die durch Publikationen und in Gesprächen vermittelt wird, aufgenommen und in Politik umgesetzt wird, ist nur schwer zu beantworten. Doch aus der Mitwirkung an einzelnen Beratungsprojekten lassen sich einige Schlussfolgerungen zur Bedeutung wissenschaftlicher Beratung ziehen und Überlegungen anstellen, inwiefern Osteuropaforscher auf politische Entscheidungen überhaupt einwirken können.
Der Arbeitskreis für Ost-West-Fragen 1986/87
Im „Arbeitskreis für Ost-West-Fragen“ diskutierten Vertreter des Auswärtigen Amtes und des Verteidigungsministeriums mit Mitarbeitern des BIOst und der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sowie Angehörigen der Universitäten über die aktuellen Entwicklungen im „Ostblock“. Hauptthema war damals die Frage, wie die Entwicklung in der Sowjetunion zu bewerten sei, in der der neue Generalsekretär Michail Gorbačev begann, Reformen in die Wege zu leiten. In der westlichen wie in der deutschen Öffentlichkeit gab es dazu gegensätzliche Ansichten. Das galt auch für die deutsche Osteuropaforschung. Während eine Gruppe von Wissenschaftlern die Ansicht vertrat, dass Gorbačevs Reformen zu einer grundlegenden Umgestaltung des Systems und zu Veränderungen im Verhältnis zwischen West und Ost führen könnten, bestanden andere darauf, dass es dem Generalsekretär nur um eine Atempause gehe, darum, das System effektiver und in der Konkurrenz mit dem Westen leistungsfähiger zu machen. Der Kommunismus würde durch die Reformen eher noch bedrohlicher.[16] Die Polarisierung war erheblich und der Meinungsstreit erfasste auch das BIOst. Während ein großer Teil der älteren Wissenschaftler die fortdauernde kommunistische Gefahr betonte, interpretierten der Direktor, Heinrich Vogel, der Forschungsbereichsleiter Wirtschaft, Hans-Hermann Höhmann, und viele jüngere Forscher die Reformen Gorbačevs als Reaktion auf eine soziale und ökonomische Zwangslage und erwarteten fundamentale Änderungen in der sowjetischen Außen- und Innenpolitik. Die Stimmung im Hause war angesichts der Meinungsunterschiede durchaus gespannt.
Unterschiedliche Einschätzungen gab es auch in der Regierung. Bundeskanzler Kohl hatte Gorbačev im Oktober 1986 in einem Newsweek-Interview mit Goebbels verglichen.[17] Indes bewertete man im Auswärtigen Amt (AA) unter Außenminister Hans-Dietrich Genscher den sowjetischen Generalsekretär Michail Gorbačev als ernsthaften Reformer. Im Verteidigungsministerium (BMVg) unter Manfred Wörner wiederum konnte man keinen wirklichen Ansatz zu Veränderungen in der Sowjetunion erkennen. Im Ost-West-Arbeitskreis standen sich daher die Vertreter des BMVg und des Auswärtigen Amtes gegenüber.
Meine Einladung in den Arbeitskreis verdankte ich wohl vor allem der Tatsache, dass ich mich in meinen Analysen dafür eingesetzt hatte, Gorbačevs Reformen ernst zu nehmen. Ich wurde rasch von den Beamten des AA „adoptiert“, während sich die Offiziere des BMVg an die älteren Kollegen hielten, mit denen ich im Institut durchaus über Kreuz lag. Der Konflikt zwischen den Ressorts wurde als Streit zwischen akademischen Kollegen ausgetragen. Aus dieser Erfahrung waren zwei Schlüsse zu ziehen: Erstens, die Forschung bietet auf Anfragen der Politik meist zwei oder mehr Antworten an; und zweitens, die meisten Akteure in der Politik suchen die Beratung nicht, um sich eine Meinung zu bilden, sondern sie suchen sich den Wissenschaftler aus, der ihre Meinung bestätigt.
Die Regierung Kohl und der erste Tschetschenienkrieg
Eine weitere Erfahrung machte das Bundesinstitut im Frühjahr 1995. Ende 1994 hatte Russlands Regierung sich entschieden, den Konflikt mit der tschetschenischen Führung, die den Austritt ihrer Region aus der Russländischen Föderation anstrebte, gewaltsam zu lösen. Am 11. Dezember 1994 marschierten Streitkräfte in die Region ein. Ende des Monats griffen sie die tschetschenische Hauptstadt Groznyj an, stießen aber auf heftigen Widerstand. In den zweimonatigen Kämpfen starben dort durch Luftangriffe und Artilleriebeschuss ca. 25 000 Menschen. Bundeskanzler Kohl gab am 13. Januar 1995 eine Erklärung ab, dass die Bundesregierung das menschliche Leid bedauere, der Konflikt aber eine innerrussische Angelegenheit sei.[18] Indes entstand im BIOst eine Reihe von Aktuellen Analysen zu Tschetschenien. Uwe Halbach untersuchte die Entstehung des Konflikts und die Argumente, mit denen Moskau sein gewaltsames Eingreifen rechtfertigte.[19] Heinz Timmermann thematisierte die Brutalität der Kriegführung und die Kritik des Europarats an Russland. Er erklärte, dass der Tschetschenienkrieg keineswegs eine innerrussische Angelegenheit sei.[20] Und Dieter Heinzig untersuchte die rechtliche Seite. Er verwarf zwar die Behauptung, dass sich Tschetschenien rechtswirksam von Russland getrennt habe, doch er kritisierte auch das brutale Vorgehen der Zentralregierung in Moskau.[21]
Das Bundesinstitut hatte unmittelbar auf die Krise reagiert und diese in ihren verschiedenen Facetten beleuchtet. Die Untersuchungsergebnisse bestätigten die Aussagen des Bundeskanzlers nicht. Wie üblich wurden diese „Aktuellen Analysen“ breit verteilt, auch das Bundeskanzleramt und die einschlägigen Ressorts gehörten zu den Empfängern. Einige Wochen gab es keine Reaktion aus der Politik. Das Ergebnis der Analysen wurde nicht zur Kenntnis genommen. Dann veröffentlichte eine Tageszeitung eine kurze Notiz mit der Überschrift „Eine Bundesbehörde widerspricht dem Bundeskanzler“. Diese Pressenotiz löste eine Reaktion aus: Das Bundeskanzleramt signalisierte seinen Unwillen und veranlasste den Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Direktoriums des BIOst, den Kölner Politikwissenschaftler Werner Link, beim Geschäftsführenden Direktor des Instituts, Heinrich Vogel, zu intervenieren. Es blieb allerdings bei einer Verwarnung. Materiell hatte der „Fehltritt“ keine Folgen.
Aus dieser Erfahrung lassen sich wiederum zwei Schlüsse ziehen: Erstens wurden die Analysen offenbar nicht zur Kenntnis genommen. Die Veröffentlichung von abweichenden Meinungen in einem auf das Fachpublikum orientierten Medium war möglich – und folgenlos. Anders eine Meldung in der Tagespresse – diese rief eine unmittelbare Reaktion von Seiten der operativen Politik hervor. Politik erreichte man nicht durch Fachpublikationen, sondern durch Berichterstattung in den Massenmedien. Zweitens nahm die Politik – wenigstens die Regierung Kohl – abweichende Meinungen nicht als Diskussionsbeitrag auf, auf den sie inhaltlich einging, sie strafte abweichende Meinungen ab – auch wenn dies im vorliegenden Falle folgenlos blieb.
Die NATO-Osterweiterung
Eine weitere Lehre ergab sich aus dem Entscheidungsprozess für die NATO-Osterweiterung. Der Fall der „Mauer“ und die Auflösung des „sozialistischen Lagers“ Ende der 1980er Jahre hatten die sicherheitspolitische Situation in Europa grundlegend verändert. Damit stellte sich auch die Frage, welche Rolle die NATO nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation spielen sollte. Das erforderte eine politische und sicherheitspolitische Neubewertung der europäischen Entwicklung, wobei auch der Beitrag der USA und die möglichen Einwirkungen eines sich wandelnden Russlands zur Diskussion standen.[22] Schon früh wurde dabei auch darüber nachgedacht, ob ostmitteleuropäische Staaten wie Polen, die Tschechoslowakei bzw. nach deren Auflösung Tschechien und die Slowakei sowie Ungarn in die NATO eintreten könnten.[23] Diese Staaten schlossen sich im Februar 1991 als Visegrád-Gruppe zusammen, um gemeinsam den Beitritt zur EU und die Annäherung an die NATO zu betreiben. In Deutschland wurde die Frage der NATO-Erweiterung von Volker Rühe, der am 1. April 1992 die Leitung des Verteidigungsministeriums übernahm, offensiv thematisiert.[24] Dabei wurde er von seinem Planungsstabschef, Vizeadmiral Ulrich Weisser, aktiv unterstützt, der Rühe bei Amtsantritt riet, seinen Namen mit einem historischen Projekt zu verbinden: „Öffnen Sie die NATO für neue Mitglieder.“[25] Rühe machte sich die Idee zu eigen, ohne diese Politik zur Gänze mit Bundeskanzler Kohl und Außenminister Genscher abgestimmt zu haben. Ulrich Weisser, der in Bonn und Köln als genialer strategischer Kopf galt, sorgte dafür, dass Rühe seine Vorstellungen im März 1993 im Londoner International Institute for Strategic Studies im Rahmen der „Alastair Buchan Memorial Lecture“ einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen konnte. In seiner Rede, die wesentlich von Weisser mitformuliert worden war, plädierte Rühe für eine Revitalisierung Ost- und Ostmitteleuropas, für eine Überwindung der europäischen Spaltung und für eine Öffnung der NATO.[26] Mit diesem Vortrag hatten Rühe und Weisser einen Stein ins Wasser geworfen, der Wellen schlug, aber auch Gegenreaktionen hervorrief. Um ihre Position in der Diskussion mit den Kritikern in Deutschland, den USA und den anderen NATO-Staaten zu stützen, beauftragte Rühe die RAND-Stiftung in Kalifornien, ein Gutachten über die NATO-Erweiterung zu erstellen:
"Ich hatte die politische Strategie im Sinn, die NATO zu öffnen. Aber ich brauchte Hilfe, um es umzusetzen. Deshalb habe ich RAND engagiert. Ich brauchte sie, um meine Ideen zu verfeinern und die nächsten Schritte zu skizzieren. Es gab so viele Dinge zu tun. Weisser und ich waren mit RAND schon lange vertraut. Sie waren offen und befürworteten unseren Ansatz. RAND hat uns geholfen, schrittweise Anstrengungen zu unternehmen. Alle drei bis sechs Monate kam der RAND-Mitarbeiter Ronald Asmus vorbei, um zu berichten, woran sie gearbeitet hatten. Wir haben uns dann für die nächsten Studien entschieden. Asmus und ich kannten uns sehr gut. Weisser war der Vermittler. Im Wesentlichen habe ich RAND bezahlt, um mir zu helfen, etwas zu tun, das gegen die außenpolitische Position der Vereinigten Staaten verstößt. RAND war sehr mutig, mit mir zu arbeiten. Vertreter der US-Regierung warnten sie davor. Aber ich war sehr unkonventionell.
Kein deutscher Think Tank hat mich unterstützt. Sie waren alle dagegen. Die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) wäre die einzige Denkfabrik in Deutschland gewesen, die mir wirklich hätte helfen können, die Schritte zur NATO-Mitgliedschaft für die ostmittel- und osteuropäischen Länder zu entwickeln. Ich fragte sie. Michael Stürmer, der Chef der SWP, war total dagegen."[27]
Die RAND-Studie wurde Anfang 1995 in Survival publiziert und diente in Deutschland und anderen NATO-Ländern als Argumentationsgrundlage für die Erweiterungspolitik.[28] Auf dem NATO-Gipfel am 8. und 9. Juli 1997 in Madrid wurde die Idee dann in die Tat umgesetzt. Polen, Tschechien und Ungarn wurde die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen angeboten.
Aus Rühes und Weissers Berichten wird deutlich, dass die Rolle der Beratungsinstitutionen in diesem Prozess schwach war. Den Entschluss, die NATO-Erweiterung politisch voranzutreiben, fassten Rühe und Weisser, ohne Beratungsinstitutionen und andere Ressorts konsultiert zu haben. Selbst in der Bundeswehrführung hatten die beiden nur geringen Rückhalt. Wissenschaftliche Beratung zogen sie erst in einem zweiten Stadium heran, als es vor allem darum ging, der eigenen Position Legitimität zu sichern. Dazu wählten sie mit RAND einen Thinktank aus, von dem man sicher sein konnte, dass die Autoren den Standpunkt des Bundesverteidigungsministers teilten.[29] Von Bedeutung war auch, dass der Stimme von RAND in der amerikanischen Innenpolitik und in anderen NATO-Ländern mehr Gewicht beigemessen wurde als der Studie eines deutschen Instituts. Aber Rühe sagt auch deutlich, dass er die Stiftung Wissenschaft und Politik deshalb nicht beauftragte, weil deren Führung seine Position nicht teilte. Die Entscheidung war schon gefallen und der Verteidigungsminister nicht bereit, Gegenargumente zu hören.
Dass das Bundesinstitut nicht angesprochen wurde, mag damit zusammenhängen, dass es als Regionalforschungsinstitut nicht für die Behandlung strategischer Themen prädestiniert war. Aber das BIOst hätte sehr viel zu der Frage beitragen können, wie die deutsche Politik in Osteuropa wahrgenommen wurde und wie mögliche Reaktionen ausfallen könnten. Wie intensiv zwischen 1994 und 1997 zu diesen Themen gearbeitet wurde, zeigen die Jahrbücher des Instituts und eine Sammelstudie, die 1996 Russlands Rolle in einem europäischen Kontext untersuchte.[30] Unter den zahlreichen Analysen, die im BIOst entstanden, war auch eine Kurzstudie, die Anfang 1997 wenige Monate vor dem Madrider Gipfel veröffentlicht wurde und in der eine Europapolitik angemahnt wurde, die die Öffnung der NATO flankierte:
"Elemente einer europäischen ,Ostpolitik'“
Für eine verantwortungsbewußte russische Führung ist die Ausdehnung der NATO nach Osten aus wohlverstandenem Sicherheitsinteresse unannehmbar, sofern diese nicht von handfesten Garantien für die russische Seite – etwa im Bereich der Stationierung nuklearer Waffen – und von Abmachungen zwischen Rußland und der NATO über reale Zusammenarbeit begleitet sind. Flankiert werden müssen diese Vereinbarungen von einer engeren wirtschaftlichen Anbindung Rußlands an die Europäische Union. Schließlich muß die NATO-Ausdehnung auch von einer Neuverhandlung der konventionellen Kräfteverhältnisse in Europa begleitet werden. Dabei gilt es, die Kräfteverhältnisse in der Berührungszone von NATO und Rußländischer Föderation so zu definieren, daß Rußland mittel- und langfristig davon ausgehen kann, an seiner Westflanke keiner Bedrohung ausgesetzt zu sein. Im Gegenzug muß die militärische Präsenz Rußlands gegenüber Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn und den baltischen Republiken soweit vermindert werden, daß diese vor einer strategischen Überraschung geschützt sind. Dies ist eine komplexe Aufgabe, deren Lösung viel guten Willen von beiden Seiten erfordert.
Doch keiner der Beteiligten kann daran interessiert sein, daß an der Nahtstelle zwischen Rußland und dem Rest von Europa eine Zone der Konfrontation entsteht. Mag sein, daß die Diskussion um die NATO-Erweiterung in einem solchen Verhandlungskontext ein nützliches Instrument ist, um Gesprächspartner im östlichen Teil von Europa zu motivieren, sich am Aufbau einer funktionierenden Sicherheitsstruktur zu beteiligen. Die NATO-Erweiterung allein löst die drängenden Probleme in diesem Raum nicht und schafft dort auch keine allgemeine Sicherheit.[31]
Im Rückblick kann man sagen, dass die Feststellung, die NATO-Erweiterung werde in Ost- und Ostmitteleuropa keine allgemeine Sicherheit herstellen, zutreffend war. Allerdings kam die Kurzstudie zu spät. Die politische Entscheidung war längst gefallen. Die Empfehlungen der Kurzstudie standen den Ideen Rühes und Weissers nicht entgegen. Bei der Ausgestaltung ihrer Politik hatten sie von Anfang an die Notwendigkeit gesehen, Russland konstruktiv einzubinden, und eine Doppelstrategie entworfen, bei der die NATO-Erweiterung von einer aktiven Einbeziehung Russlands flankiert wurde. Dieser Kurs wurde danach allerdings nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit verfolgt.
Dass wissenschaftlicher Rat deutsche Thinktanks von der Politik nicht abgefragt wurde, war im Übrigen kein Einzelfall. Helmut Schmidt berichtet in einem seiner Erinnerungsbücher, in dem er sich u.a. mit wissenschaftlicher Politikberatung sehr kritisch auseinandersetzt, dass die Kohl-Regierung bei der deutschen Vereinigung 1990 und 1991 das Wissen der bundesdeutschen DDR-Forschung weitgehend ignorierte.[32]
Wenn die politische Führung sich auf die eigene Kompetenz verlässt und es für überflüssig hält, externen Rat einzuholen, haben Wissenschaftler kaum noch Möglichkeiten, auf den Entscheidungsprozess einzuwirken. Wissenschaftler sind nicht klüger als Politiker, aber ihr Wissen einfach zu ignorieren, ist mitunter unheilvoll – und für die Wissenschaftler immer frustrierend. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, dass Hans-Hermann Höhmann, der Forschungsbereichsleiter Wirtschaft am Bundesinstitut, Politikberatung gern als „Kunst am Bau“ bezeichnete, oder – in schlimmeren Momenten – als „Bordkapelle auf der Titanic, die ‚Näher mein Gott zu Dir‘ spielt“ – während das Schiff auf den Eisberg zufährt.
„Russland 2012“: Perspektiven für die Medvedev-Jahre
Nicht alle Erfahrungen mit Beratungsprojekten sind negativ. Es gibt auch Ausnahmen. Für Frühjahr 2008 standen in Russland Präsidentschaftswahlen an. Vladimir Putin konnte nach zwei Amtszeiten (2000–2004 und 2004–2008) nicht zur Wahl antreten, da die Verfassung dies nicht zuließ. In Russland gab es eine lebhafte Diskussion über die Frage der Nachfolge, und auch in Deutschland und Europa wurde spekuliert, in welche Richtung sich Russland weiterentwickeln werde. Aus diesem Grunde wandte sich im Frühjahr 2007 der Planungsstab des Auswärtigen Amtes an die Forschungsgruppe Russland/GUS in der Stiftung Wissenschaft und Politik und schlug vor, die mögliche Entwicklung Russlands gemeinsam in einem Szenarioverfahren auszuloten. Die Szenario-Technik hatte sich die SWP in einem gemeinsamen Projekt mit der „Forschungsgruppe Gesellschaft und Technik der Daimler AG“, dem Daimler-Thinktank, angeeignet[33] und konnte dieses Wissen nun in die Kooperation mit dem Planungsstab einbringen. Drei Wissenschaftler der SWP, Rainer Lindner, Roland Götz und der Verfasser gingen in die Arbeitsgruppe, vom Auswärtigen Amt waren drei Diplomaten beteiligt. Zeitweise wurden weitere Referenten des AA hinzugezogen. Die Gruppe nahm ihre Arbeit im Mai 2007 auf, analysierte die Situation in Russland, identifizierte Einflussfaktoren und entwickelte eine Wirkungsmatrix. Auf dieser Basis wurden drei Szenarien definiert: erstens das Szenario eines autoritären Kurses im Inneren und einer Expansion nach außen (imperial-autoritäres Russland), zweitens das Szenario einer Politik, die auf der Stelle tritt (Von der Stabilität in die Stagnation) und schließlich das Szenario einer durchgreifenden Modernisierung („Russisches Davos“. Das „liberale“ Projekt). Ausgehend von diesen „Zukunftserzählungen“ formulierte die Gruppe Politikempfehlungen. Im November 2007 legte sie ihren Abschlussbericht vor.[34] Dessen Ergebnisse gingen in die Formulierung einer neuen Russlandpolitik ein, die auf den neuen Präsidenten Dmitrij Medvedev zugeschnitten war, der am 2. März 2008 gewählt wurde. Zwei Tage nach dessen Wahl formulierte Außenminister Frank-Walter Steinmeier öffentlich die Prinzipien seiner Russlandpolitik:
"Das Land steht vor gigantischen Modernisierungsaufgaben: eine zerfallende Infrastruktur, ein riesiger Investitionsbedarf, eine übergroße Abhängigkeit von Rohstoffexporten, die Gefahr der Deindustrialisierung und eine sich anbahnende demographische Katastrophe. In all diesen Bereichen besteht dringender Handlungsbedarf für die russische Politik. Und russische Politiker wissen: Europa ist der natürliche Modernisierungspartner ihres Landes!"[35]
In dieser Rede rief er zu einer „Modernisierungspartnerschaft“ zwischen Deutschland und Russland auf – ein Konzept, das auch von der Europäischen Union aufgegriffen wurde.[36]
Das Szenarioprojekt „Russland 2012“ war ein Muster, wie Politikberatung funktionieren kann. Es wurde eine politisch relevante Aufgabenstellung definiert, die Wissenschaftler und Beamte des Auswärtigen Amtes ergebnisoffen diskutierten. Die Arbeitsgruppe hatte ausreichend Zeit, um die Probleme zu erörtern und zu plausiblen Schlussfolgerungen zu kommen. Das Ergebnis wurde im Auswärtigen Amt aufgenommen und ging in ein politisches Konzept ein, das deutsche und dann auch europäische Russlandpolitik über mehrere Jahre hin prägte. Möglich war das, weil der Außenminister bereit war, seinem Stab genug Spielraum zu geben, der Leiter des Planungsstabes an systematischer und vorausschauender Analyse interessiert war und der Russlandexperte des Planungsstabes die Mühe auf sich nahm, eine solche Szenario-Analyse zu erarbeiten.
Dieses erfolgreiche Beratungsprojekt hatte ein ironisches Nachspiel. Der Abschlussbericht „Russland 2012“ wurde im AA als Verschlusssache (VS NfD) eingestuft. Da keiner der beteiligten Wissenschaftler eine Sicherheitsermächtigung und damit Zugang zu Geheimsachen hatte, bekamen sie die offizielle Version des AA nicht in die Hand und wurden zudem vergattert, die Tatsache, dass ein solcher Szenarienprozess stattgefunden hatte, nicht öffentlich zu erwähnen. Insofern waren sie verwundert, als sich große Teile der Studie im September 2008 im Spiegel wiederfanden.[37] Da dort auch wörtliche Zitate erschienen, musste man davon ausgehen, dass der Spiegel-Redaktion ein Exemplar der vertraulichen Studie vorgelegen hatte. Wie es dazu gekommen war, lässt sich nur vermuten: Im Juli 2008 hatte sich der Konflikt zwischen Südossetien und Georgien zugespitzt und am 8. August gingen die georgischen Streitkräfte zur Offensive über. Daraus entwickelte sich ein kurzer, heftiger Krieg zwischen Russland und Georgien. In Deutschland wurde Steinmeier wegen seiner angeblich naiven, russlandfreundlichen Haltung kritisiert. Die Szenarienanalyse hatte aber den Fall eines bewaffneten Konflikts im Kaukasus durchgespielt und in das worst case-Szenario aufgenommen. Indem die Studie nun an den Spiegel durchgestochen wurde, konnte man zeigen, dass Steinmeier im Vorfeld alle Möglichkeiten durchdacht und auch kritische Entwicklungen antizipiert hatte. Das Projekt hatte Vorarbeiten zur Formulierung einer politischen Strategie geleistet. Aber darüber hinaus diente es mit der späteren Veröffentlichung im Spiegel auch der Rechtfertigung eines Ministers und seiner Politik. Dass die Verantwortlichen der Ansicht waren, die Studie könne zeigen, dass der Minister weitsichtig und kritisch sei, war natürlich auch ein – etwas verqueres – Kompliment an die Autoren des Szenarios.
Eine neue europäische Sicherheitsordnung: Medvedevs Berliner Rede
„Russland 2012“ war ein politikzentrierter Beratungsprozess. Im Umfeld des Außenministers bestand Bedarf an politischer Analyse, die für die operative Politik Zuständigen gingen auf die Wissenschaftler zu und formulierten die Aufgabe. Wichtig war, dass die Politik kein Ergebnis vorgab und der Diskurs, den Beamte und Wissenschaftler führten, ergebnisoffen und auf Augenhöhe verlief.
Im Jahr 2008 versuchte die Forschungsgruppe Russland/GUS von sich aus, einen Beratungsprozess in Gang zu setzen. Dieser war insofern wissenschaftszentriert, als die Initiative vom Institut ausging und es auch die Problemstellung formulierte. Inhaltlich ging es um die Frage, wie die deutsche oder EU-Außenpolitik auf das Angebot für einen neuen Sicherheitsvertrag reagieren sollte, das Präsident Dmitrij Medvedev in seiner Berliner Rede vom 5. Juni 2008 vorgebracht hatte.[38] Der Vorschlag wurde in der westlichen Öffentlichkeit eher reserviert aufgenommen. Die weitere Diskussion wurde wegen des Kriegs zwischen Russland und Georgien unterbrochen.[39] Medvedev nahm seinen Vorschlag am 8. Oktober in einer Rede vor der Konferenz für Weltpolitik in Evian wieder auf.[40] Die westlichen Reaktionen blieben skeptisch. Man beschränkte sich darauf, das Dialogangebot im Rahmen des Korfu-Prozesses der OSZE zu erörtern.
In dieser Situation entstand in der SWP-Forschungsgruppe Russland/GUS die Idee, auf der Arbeitsebene der Ressorts in Reaktion auf die Vorschläge Medvedevs eine intensivere Erörterung der Zukunft europäischer Sicherheit zu initiieren. Hintergrund war die Beobachtung, dass Medvedev am 10. September mit seinem Artikel „Russland Vorwärts!“[41] eine umfassende innen- und wirtschaftspolitische Wende einzuleiten versuchte, und die Annahme, dass sich im Kontext der Modernisierungsbemühungen trotz der Russland-Georgien-Krise Chancen für eine Versachlichung der Beziehungen zu Russland ergeben könnten. Die SWP lud daher Mitarbeiter aus dem Bundeskanzleramt, dem Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium für Verteidigung zu vier Workshops im Rahmen eines Arbeitskreises „Europäische Sicherheitsordnung“ ein. Diese Workshops "sollen eine Plattform für eine vertiefte Diskussion zu den derzeitigen Defiziten und Entwicklungsperspektiven des europäischen Sicherheitssystems bieten. Dabei geht es nicht darum, sich an den russischen Vorschlägen „abzuarbeiten“, sondern zu untersuchen, wo von deutscher und europäischer Seite aus Bedarf für eine Anpassung oder Neugestaltung der europäischen Sicherheitsordnung besteht."[42]
Tatsächlich wurde der Vorschlag positiv aufgenommen. Auf den Sitzungen wurde intensiv und konstruktiv diskutiert. Die Teilnehmer aus den Ressorts begrüßten die Gelegenheit, mit Kollegen aus anderen Ministerien auf neutralem Terrain diskutieren zu können. So trug die Initiative der SWP ihre Früchte. Beratung erfüllte hier ihre Rolle in der Organisation eines interministeriellen Dialogs, der durch Informationen aus der wissenschaftlichen Diskussion angereichert wurde. Die Federführung des Arbeitskreises lag bei Margarete Klein und Solveig Richter, die 2011 eine Studie publizierten, in der Ergebnisse der Diskussionen präsentiert und ausgewertet wurden.[43] Das Projekt zeigte aber auch die Grenzen der Beratungsarbeit. Der Dialog mit den Vertretern der Ressorts war zwar fruchtbar, er führte jedoch nicht dazu, dass man auf politischer Ebene über eine Neubelebung des Sicherheitsdialogs mit Russland nachdachte, die zu diesem Zeitpunkt sicher möglich gewesen wäre und Gesprächskanäle geöffnet hätte, die in der Phase der Verschlechterung der Beziehungen nach 2012 vielleicht nützlich gewesen wären.
Lehren aus der Beratungserfahrung
Die Grundlage der Beratungsarbeit war das kontinuierliche Gespräch mit Partnern auf der Arbeitsebene der Ressorts, in den Fraktionen, den Verbänden und den Parteistiftungen. Der Austausch war manchmal mehr, manchmal weniger intensiv, bot aber meist die Möglichkeit, Ergebnisse eigener wissenschaftlicher Arbeiten in die Politik zu vermitteln. Das daraus erwachsene Vertrauen gestattete es, auch größere Beratungsprojekte anzuregen. Hier waren die Erfahrungen eher gemischt: Die Prozesse waren meist politikzentriert und politikgesteuert, und die politische Seite nutzte die wissenschaftliche Beratung eher zur Legitimierung als zum Überdenken eigener Positionen. Es zeigte sich auch, dass wissenschaftliche Beratung in der Regel zu weit von den Entscheidungsprozessen entfernt war, um diese wirksam zu beeinflussen. Entscheidungen fällten die politischen Spitzen der Ressorts, die sich auf die Beratung durch die eigenen Apparate stützten. Sie bezogen neben Sachgesichtspunkten auch eigene politische und taktische Überlegungen in die Entscheidungsfindung ein. Externe wissenschaftliche Beratung leistete in diesem Prozess einen Beitrag, doch der war in der Regel nicht entscheidend.
Politikberatung als Interaktion von Politik und Wissenschaft
An dieser Stelle ist es sinnvoll, noch einmal das Verhältnis von Politik und Wissenschaft zu überdenken. Politiker und Wissenschaftler agieren in unterschiedlichen Welten und sind der Logik und den Zielen ihrer Profession verpflichtet, so dass das Verhältnis zwischen ihnen sich nicht einfach gestaltet. Etliche Sozialwissenschaftler haben die Interaktion von Politik und Wissenschaft untersucht und die Probleme in der Praxis der Politikberatung thematisiert. Es sei insbesondere an die Arbeiten von Jürgen Habermas, Klaus von Beyme, Eva Kreisky, Peter Weingart und der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Wissenschaftliche Politikberatung erinnert. Mit Wolfgang Streeck und Dirk Messner haben sich auch Leiter großer, politiknaher Forschungseinrichtungen zu Wort gemeldet.[44]
Generell bewerteten die Wissenschaftler den Wert von Beratung eher skeptisch. Wolfgang Bonß konstatierte 2004: "Die Erfahrungen mit der wissenschaftlichen Politikberatung der letzten vier Jahrzehnte sind eher enttäuschend. Denn sie haben kaum zu der erhofften Rationalisierung der Politikformulierung geführt."[45]
Bonß leugnet die Bedeutung von wissenschaftlicher Beratung nicht, doch für ihn stellte sich die Beziehung zwischen Wissenschaft und Politik in der Praxis als komplex und widersprüchlich dar. Ein grundsätzliches Dilemma ist die unterschiedliche Legitimitätsgrundlage. Die Interdisziplinäre Arbeitsgruppe der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, die 2008 Leitlinien für Politikberatung entwarf, beschreibt das Problem so:
"Wissenschaft und Politik stehen … in einem Spannungsverhältnis hinsichtlich der Grundlagen ihrer Legitimität. Die Politik wird durch demokratische Zustimmung der Öffentlichkeit legitimiert. […]. Wissenschaft ist nur dann glaubwürdig, und verfügt als solche über eine besondere Autorität, wenn ihr Objektivität bzw. Neutralität gegenüber Interessen zugeschrieben wird." [46]
Leiten Politik und Wissenschaft ihre Legitimität aus unterschiedlichen Quellen ab – einerseits aus demokratischen Verfahren, andererseits aus dem wissenschaftlichen Prozess, der rational begründete, nicht interessengeleitete Ergebnisse anstrebt, so müssen sie auch in der „Logik“ ihrer Teilsysteme agieren. Daraus ergeben sich oft Missverständnisse, weil die Akteure die Handlungslogik der jeweils anderen Seite nicht verstehen. Dirk Messner, seinerzeit Wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik in Bonn, beschreibt das so:
"Denn hinter der Frustration vieler Politikberater über die „Beratungsresistenz“ und das Desinteresse der politisch Handelnden an den Problemlösungsangeboten der wissenschaftlichen Politikberatung stecken oft nicht etwa Pathologien der verantwortlichen Entscheider oder gar des ganzen politischen Systems, sondern beschreibbare Logiken kollektiven Handelns in komplexen Institutionenlandschaften, die nicht nur, aber auch typisch für „die Politik“ sind."[47]
Politiker und Wissenschaftler agieren in ihren Netzwerken sowie in einem Geflecht von Interessen und Abhängigkeiten. Das stellt Ansprüche an einen Wissenschaftler, der sich auf Politikberatung einlässt. Dirk Messner formuliert dies deutlich:
"Die Überlegungen von Mayntz zeigen zugleich, dass tragfähige politikorientierte Sozialwissenschaften ziemlich anspruchsvolle Forschungsstrategien implizieren – und eine permanente Zumutung für die Politik darstellen, denn sie können nur selten einfache Antworten auf zunehmend komplexe Fragen geben. Einfache Auswege aus diesem schwierigen Verhältnis zwischen einer den Kriterien und Möglichkeiten der Wissenschaft genügenden anwendungs- und politikorientierten Forschung und der Politik gibt es nicht. Prinzipienlose Politikberatung unterhalb der erreichten Standards und Potenziale der Sozialwissenschaften würde zwar „bequemere“ Antworten produzieren, jedoch die tatsachlich komplexen Problemkonstellationen, Zielkonflikte, Widersprüchlichkeiten, Spannungsfelder und Ambiguitäten ausblenden, die moderne Gesellschaften unter Bedingungen der Globalisierung auszeichnen."[48]
Messners Ansatz ist nachvollziehbar, aber stößt in der Praxis rasch an Grenzen. Denn die Gefahr ist groß, dass die politische Seite sich der „Zumutung“ entzieht und eben auf die „bequemen“ Antworten zurückgreift. Ohnehin erleben viele Politiker, dass Expertenwissen nicht unbedingt eindeutig und endgültig ist:
"Zu jeder Expertise gibt es eine Gegenexpertise, und diese Erfahrung trägt nicht unbedingt zu einer Erhöhung der Autorität und Glaubwürdigkeit der Experten bei, sondern zu einem wachsenden Skeptizismus."[49]
Politiker sind daher oft in der Lage, Expertise zu finden, die ihre eigenen Positionen bestätigt.
Wissenschaftliche Politikberatung in der Praxis
Der grundsätzliche Unterschied zwischen der Welt der Politik und der Welt der Wissenschaft, den Weber beschreibt, ist in der Beratungspraxis unmittelbar erfahrbar. Politiker und Wissenschaftler haben unterschiedliche Aufgaben und sie verfolgen unterschiedliche Ziele:
- Politik agiert handlungs- und entscheidungsorientiert. Sie muss Kompromisse eingehen, auf Konsensbildung setzen, da sie im parlamentarischen System ohne in demokratischen Verfahren gewonnenen Mehrheiten keine Entscheidungen umsetzen kann.
- Wissenschaft arbeitet erkenntnisorientiert, sie muss nicht handeln, Entscheidungen treffen oder Kompromisse eingehen. Sie ist an die Regeln und Methoden des Faches gebunden und an die Gepflogenheiten des Wissenschaftsbetriebes.
Diese unterschiedliche Ausrichtung hat praktische Auswirkungen:
- Bei der Bestimmung der Themen reagiert Politik auf Handlungsdruck, Wissenschaft folgt dem Diskurs des Faches. Im Idealfall behandelt Wissenschaft auch politisch relevante Fragen, legt aber den Schwerpunkt auf die Analyse und nicht auf die Entscheidung. Politik wiederum muss auf Probleme reagieren, wenn sie auftreten, und Lösungen anbieten, auch wenn die Handlungsoptionen noch nicht bis zum Ende durchdacht sind.
- Politik handelt unter Zeitdruck auch mit unvollständigen Informationen. Für die Wissenschaft gilt Hegels Formulierung: „Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug.“[50] Sie verfügt erst mit Zeitverzug über die notwendige, umfassende Information, um ein Problem angemessen zu analysieren. Seriöse wissenschaftliche Ergebnisse kann es daher erst geben, wenn der – politische, gesellschaftliche oder ökonomische – Prozess vorbei oder wenigstens weit fortgeschritten ist.
- Politik benötigt kurze, präzise ausformulierte Analysen, die plausible Handlungsoptionen entwerfen. Das Ideal ist das zweiseitige „Memo“ mit zwei, drei klaren Handlungsvorschlägen für die verantwortliche Person, welche die Entscheidung zu treffen hat. In der Wissenschaft dagegen gilt die ausführliche, theoretisch begründete und methodisch sauber ausgearbeitete Untersuchung als Norm, die komplexe Sachverhalte komplex darstellt. Handlungsbezüge sind nicht von Bedeutung. Die übliche Publikationsform war früher die Monographie, heute ist es eher der Aufsatz in wissenschaftlichen Fachzeitschriften, sogenannten peer reviewed journals.
Arbeits- und Darstellungsweisen der Wissenschaft sind mit den Anforderungen, welche die Politik stellt, nicht kompatibel. Wenn Wissenschaftler der „Politik“ Ergebnisse ihrer Arbeit zur Verfügung stellen, sie „beraten“, dann werden sie zu Akteuren im Politikbetrieb und müssen sich auf seine Strukturen und Handlungslogik einlassen. In der Bundesrepublik und in den meisten Demokratien der westlichen Hemisphäre werden Entscheidungen von Regierungen gefällt, deren Legitimität auf freien und allgemeinen Wahlen beruht, die sich auf Fachapparate stützen, und auf die viele Interessengruppen einwirken. Der politische Prozess entwickelt sich unter den Augen einer Öffentlichkeit, die durch Medien sowie Äußerungen von Verbänden, Parteien und anderen gesellschaftlichen Gruppierungen hergestellt wird, und mitunter ihrerseits auf Entscheidungen einwirkt. Daher ist wissenschaftliche Politikberatung ein Anpassungsprozess. Der Berater muss Kompromisse machen, die auf Kosten der Wissenschaftlichkeit gehen können – eine Gefahr, der er sich aussetzt und die er reflektieren muss. Natürlich stellt sich die Frage nach dem Charakter der Zusammenarbeit. Hier sind grundsätzlich drei unterschiedliche Ansätze denkbar:[51]
- Der Beratungsprozess ist politikzentriert. Politik formuliert die Agenda und leitet davon ihre Fragen ab. Wissenschaft tritt als Dienstleister auf. Die Politik übernimmt die Ergebnisse, die genehm sind und ignoriert jene, die nicht genehm sind. Da die Politik über die Macht verfügt – sie initiiert den Prozess, stellt gegebenenfalls Mittel bereit –, ist dieses Format die Regel. Für die meisten Politiker und Beamten ist dies die Form von Politikberatung, die erstrebenswert ist. Ihre Gestaltungsmacht üben sie im Übrigen zu Recht aus, da sie durch einen demokratischen Prozess legitimiert sind.
- Der Beratungsprozess ist wissenschaftszentriert. Die Wissenschaft formuliert die Agenda und trägt sie an die Politik heran. Dies kann dann der Fall sein, wenn die Politik relevante Themen ignoriert. Wissenschaftler gehen in der Regel davon aus, dass sie „es besser wissen“ und durch den wissenschaftlichen Ansatz legitimiert sind. In den Augen vieler Wissenschaftler ist dies das erstrebenswerte Format von Politikberatung, das eine Früherkennung von Problemen ermöglicht, die es erlaubt, Maßnahmen zur Krisenprävention einzuleiten. Der Versuch, Themen an die Politik heranzutragen, scheitert aber meiner Erfahrung nach häufig am Desinteresse der Politik und der Apparate, Fragen, die nicht auf der eigenen Agenda stehen, zur Kenntnis nehmen. Oft ist dann der Weg über die Medien der einzige, mit dem man auf wichtige Themen aufmerksam machen kann.
- Der Prozess entwickelt sich „diskursiv“. Agenda und Fragen werden gemeinsam entwickelt, die Wissenschaft gibt Antworten, soweit sie dies kann. Die Gesprächspartner in der Politik nehmen dies kritisch auf und entwickeln die eigenen Frageansätze weiter. Das ist für beide Seiten ein Lernprozess zum jeweiligen Nutzen. Doch ein solches Format ist höchst selten. Voraussetzung ist, dass sich die Gesprächsteilnehmer vertrauen und genug Zeit zum Nachdenken und zur Diskussion mitbringen.
Aus der Perspektive der Politiker und der Mitarbeiter der Apparate erscheint das erste Format als das Naheliegende: Sie entscheiden und handeln in der operativen Politik, sie können daher bestimmen, in welchen Punkten sie beraten werden wollen. Aus der Sicht der Wissenschaftler ist die zweite Variante die sinnvollste, da sie glauben, über die Kompetenz und das notwendige Wissen zu verfügen und daher fähig sind, dem Prozess die Richtung und die Form zu geben. Natürlich steckt in beiden Sichtweisen ein gutes Stück Überheblichkeit – weder verfügen Wissenschaftler über alle notwendigen Informationen, noch sind Politiker und Apparate in der Lage, die Folgen ihres Handelns wirklich zu übersehen. Insofern ist der dritte Weg, die Zusammenarbeit auf Augenhöhe, sicher der vernünftigste. In der Praxis liegt die Entscheidung bei der Politik und den Ressorts, ob sie sich beraten lassen wollen, und wenn ja, wie diese Beratung aussehen soll. Auch wenn die Wissenschaft initiativ wird, entscheidet die Politik, ob sie deren Vorschläge aufnimmt.
Wenn ein Wissenschaftler sich auf einen Beratungsprozess einlässt, sei er nun politik- oder wissenschaftszentriert, so muss sich der Wissenschaftler darüber im Klaren sein, was er an Beratung anbieten kann und will. Die Journalistin Nina Grunenberg, die von 2000 bis 2009 Mitglied des Wissenschaftsrates war, widmete sich in der Wochenzeitung Die Zeit dem „Geschäft der Besserwisser“:
"Es gibt Berater, die die Politik sachlich auf Vordermann bringen (Experten), es gibt andere, die ihr konzeptionell auf die Sprünge helfen wollen (politische Denker zum Beispiel in den Universitätsinstituten für Politikwissenschaften). Aber am meisten nachgefragt wird der Rat der Operateure, der „Umsetzer“, die wissen, was geht und wie es durchzusetzen ist. Erwartet wird, dass sie die „Entscheider“ vor der „Politikverflechtungsfalle“ retten, jenem komplizierten deutschen Institutionengefüge mit seinen checks und balances und seiner eingebauten Konsensorientierung, das die Regierenden zur Verzweiflung bringt. „Manager von Organisationsprozessen“ braucht Steinmeier, „die das notwendige Verständnis für die Rahmenbedingungen unserer Arbeit aufbringen“. Nicht verwunderlich ist, dass die klassischen Unternehmensberatungen, bisher auf die Privatwirtschaft konzentriert, zusehends auch im politischen Geschäft an Boden gewinnen. Sie profitieren vom Beratungsbedarf in den öffentlichen Unternehmen."[52]
Es lohnt sich, dieser Typologie von Beratern mehr Aufmerksamkeit zu schenken:
- „Experten“ vermitteln Sachwissen, über das die Politik und die Apparate nicht verfügen, etwa im Bereich der Feinstaubmessung, der Gentechnik oder eben der Länderkunde. Insofern können sie in Entscheidungsprozessen eine Rolle spielen, sie gestalten sie aber nicht. Osteuropaforscher treten in der Regel als „Experten“ auf, vermitteln Hintergrundwissen über die Region und versuchen, der Politik das Handeln der Akteure in Osteuropa verständlich zu machen.
- „Konzeptionelle Denker“ oder „Strategen“ wirken an der Formulierung politischer Strategien mit. Im Austausch mit Praktikern bringen sie ihr theoretisches und empirisches Wissen in die Entwicklung von Konzepten ein, die Politik auf lange Sicht bestimmen. Ein Wissenschaftler, der diese Rolle einnimmt, muss bereit sein, sich auf Politik einzulassen, denn mit der Entwicklung von Strategien verlässt er das Feld der Wissenschaft.
- „Operateure/Umsetzer“ entwickeln nicht nur politische Konzepte, sie entwerfen auch Verfahren, diese im politischen Tagesgeschäft durchzusetzen, und sind bereit, ihre Konzepte so zu modifizieren, dass sie politisch realisierbar sind.
Wissenschaftler werden zumeist als „Experten“ angefragt, sie werden aber auch in „strategische Runden“ einbezogen. Als „Operateure“ treten vorwiegend erfahrene politische Praktiker auf, welche die juristischen Normen und politischen Abläufe gut kennen. Oft ist das auch Sache von Consulting Teams, die z.B. Lobbygruppen beraten und deren Anliegen in den politischen Prozess einspeisen. Aus der Sicht des Entscheiders fällt all das unter Beratung. Natürlich ist jemand, der das Problem nicht nur gut kennt, sondern auch interessante Lösungsideen hat und zudem noch weiß, wie man diese Ideen durch die Gremien bringen und der Öffentlichkeit schmackhaft machen kann, in den Augen vieler Politiker die ideale Besetzung als Berater.
Wenn man über Beratungsformen nachdenkt, dann wird deutlich, dass Wissenschaftler auf einem Beratungsmarkt agieren und kein Monopol in der Politikberatung haben. Im Gegenteil: Es gibt viele Akteure, die Beratung anbieten und sich bemühen, auf Entscheidungsprozesse einzuwirken. Politiker und ihre Stäbe haben viele Möglichkeiten, sich sachkundig zu machen:[53]
- Sie können dies auf direktem Wege tun; z.B. durch Gespräche mit ausländischen Politikern, auf internationalen Konferenzen.
- Sie werden durch ihre Apparate informiert; z.B. durch Botschaftsberichte, eigene Analysen, Gesprächszettel, durch Informationsgespräche.
- Befinden sie sich in der entsprechenden offiziellen Position, werden sie auch durch die „Dienste“ informiert, die über Quellen verfügen, die Wissenschaftlern nicht zugänglich sind.
- Sie können sich über die Medien informieren (Presseberichte, Medienspiegel, Datenbanken); dieses Mittel wird intensiv genutzt, daher sind Veröffentlichungen und Auftritte in Medien für Wissenschaftler eine Möglichkeit, ihre Einsichten der Politik nahe zu bringen.
- Die im Bundestag vertretenen Fraktionen haben parteinahe politische Stiftungen, die Auslandsvertretungen unterhalten. Deren Mitarbeiter sind in der Regel gut informiert und spielen bei der Unterrichtung der Politiker eine große Rolle;
- Auch Interessengruppen und Lobbyisten (Industrie, Consultings, Zivilgesellschaft, ausländische Akteure) tragen Information an die Politik heran.
Auf diesem Informationsmarkt muss sich Wissenschaft erst durchsetzen. Sie profitiert dabei vom „Mythos Wissenschaft“. Auf dem Beratungsmarkt ist „Wissenschaftlichkeit“ nach wie vor ein Verkaufsargument. Jeder Politiker (und jeder Lobbyist) will sich damit schmücken, dass seine Position „wissenschaftlich abgesichert“ sei. Das sichert Wissenschaftlern ihre Rolle im Beratungsprozess, doch gestaltet sich das Verhältnis von Wissenschaft und Politik durchaus widersprüchlich. Streeck beschreibt die wechselseitigen Abhängigkeiten, die dazu führen, dass Wissenschaft ihre Unabhängigkeit verliert:
Einerseits brauchen Politiker die Wissenschaft, weil die Wähler Entscheidungen wollen könnten, die „sachgerecht“ sind oder doch mit Hilfe von „Experten“ als solche dargestellt werden können, andererseits können sie sich auf sie nicht sicher verlassen; einerseits müssen sie ihre Unabhängigkeit respektieren, wenn sie aus ihrer Reputation Nutzen ziehen wollen, andererseits lädt die materielle Bedürftigkeit der Wissenschaft die Politik geradezu dazu ein, sich Forschungsergebnisse nach Maß zu bestellen.[54]
Aufgaben und Funktionen wissenschaftlicher Politikberatung
Ein Wissenschaftler, der in den Diskurs mit politischen Entscheidern eintritt, begibt sich auf ein schwieriges Terrain. Wissenschaftliche Analyse leistet einen Beitrag zur politischen Entscheidungsfindung, doch sie steht im Spannungsverhältnis zur Politik, die ihre Ziele in der fortgesetzten Auseinandersetzung mit den Interessengruppen, der Öffentlichkeit und der Notwendigkeit rationaler Problemlösung immer wieder neu formuliert. Dabei nehmen Politiker die Rolle der Wissenschaft durchaus anders wahr, als das Wissenschaftler selbst tun. Klaus von Beyme hat 1984 vier Funktionen aufgezählt, die wissenschaftliche Beratung in den Augen von Politikern haben kann:[55]
- Wissenschaft kann im Vorfeld Probleme benennen und so als Frühwarnsystem dienen, die es Politikern ermöglicht, Lösungen zu entwickeln und Krisen durch rechtzeitiges Handeln zu entschärfen.
- Im Widerspiel der Interessengruppen, die auf Politik einwirken, und in der Auseinandersetzung der beteiligten Ressorts, im bürokratischen Infight, kann wissenschaftliche Expertise helfen, Konflikte zu versachlichen. Beyme spricht von „Konfliktschlichtungsfunktion“, doch mit einem so weitgesteckten Ziel wird Wissenschaft in der Regel überfordert sein.
- Wissenschaft kann eine Überwachungsfunktion in den Bereichen übernehmen, die politische Entscheider nicht beachten, da sie ihnen tagesaktuell nicht relevant erscheinen. Wissenschaftliche Analyse ist nicht der Tagespolitik verpflichtet, sondern der Auseinandersetzung mit ihrem Gegenstand. Sie beobachtet ihre Forschungsfelder kontinuierlich.
- Wissenschaftliche Ergebnisse dienen den politischen Verantwortlichen schließlich häufig zur Rechtfertigung von Entscheidungen gegenüber der Öffentlichkeit. Die Reputation wissenschaftlicher Arbeit wird – auch im Konflikt zwischen Interessengruppen – zur Legitimation von persönlichen oder Gruppeninteressen genutzt. Das ist zweifellos problematisch, weil Wissenschaft so politisiert wird und den Wissenschaftscharakter verliert.
Der Wissenschaftler, der es als seine Aufgabe ansieht, sein Wissen der Politik und der Öffentlichkeit zu vermitteln, muss sich bewusst sein, dass er eine Dienstleistung erbringt und dass er nicht darüber bestimmen kann, wie seine Erkenntnisse genutzt werden.
Über die Begrenztheit wissenschaftlicher Politikberatung
Politikberatung stellt für Wissenschaftler eine „Grenzüberschreitung“ dar. Sie erfahren Veränderungen in der „realen“ Welt außerhalb der eigenen Disziplin viel unmittelbarer, und sie müssen sich auf andere Regeln einlassen als die, die an der Universität und im eigenen Fach gelten. Und sie müssen sich selbst eine Reihe von Fragen beantworten, die sich bei rein akademischer Arbeit nicht in dieser Form stellen:
- Da ist zunächst die Frage nach der Qualität und den Konsequenzen der eigenen Arbeit: Ist der Rat „gut“? Ist die Analyse zutreffend? Sind die Empfehlungen geeignet, um das Problem zu lösen? Sind die Problemlösungen politisch, juristisch und verfahrenstechnisch akzeptabel? Das ist nicht so einfach zu beantworten. Entscheidungsprozesse sind komplex und der wissenschaftliche Beitrag schlägt sich nur selten im Ergebnis nieder.
- Wissenschaft trifft – so Weber – keine Wertentscheidungen. Diese werden von Politikern getroffen, die Wissenschaftler leisten ihren Beitrag, indem sie die Voraussetzungen und die möglichen Konsequenzen von Entscheidungen aufzeigen.[56] Doch mitunter überschreitet ein Wissenschaftler hier Grenzen und lässt subjektive Werturteile einfließen. Oft wird dies von Entscheidern auch eingefordert, die sich dann an diesen Vorlagen abarbeiten. Zudem gibt es auch Wissenschaftler, die eine bloß instrumentelle Funktion der Wissenschaft ablehnen und die Notwendigkeit von Urteilsfindung auf Basis emanzipatorischer Kritik betonen.[57] Insofern verschwimmt die Webersche Unterscheidung zwischen „Wissenschaft als Beruf“ und „Politik als Beruf“ in der Praxis wissenschaftlicher Politikberatung allzu oft.
- Der Wissenschaftler ist immer wieder mit der Frage konfrontiert, wie seine Beratung die Politik erreichen kann. Er konkurriert auf dem Informationsmarkt mit vielen anderen Akteuren, die teilweise über größere Mittel, über bessere Informationen und bessere Verbindungen verfügen. Der Wissenschaftler muss lernen, in diesem „Rattenrennen“ zu bestehen. Das Pfund, mit dem er wuchern kann, ist der „Mythos Wissenschaft“, die Reputation, die wissenschaftliche Arbeit in der heutigen Gesellschaft genießt.
- „Operative“ Politikberatung kann Wissenschaft nicht leisten. Dazu verfügt sie weder über die nötigen Informationen, noch ist sie fähig, in real time zu reagieren. Zwar kann sie Sachwissen anbieten, das möglicherweise bei der Entscheidungsfindung hilft, doch wie die Entscheidung in der Behörde oder Partei durchgesetzt, wie sie in Verhandlungen eingebracht und politisch implementiert wird, entzieht sich dem Einfluss der Wissenschaft.
- Was Wissenschaft leisten kann, ist „strategische“ Politikberatung, d.h. die Einordnung von Ereignissen und Handlungen in mittel- und langfristige Trends, ihre Erklärung und Bewertung im Kontext. Der Vorzug der Wissenschaft ist ihr Vergangenheitswissen und ihr Blick auf lange Entwicklungsprozesse.
- Dementsprechend liegt die Chance wissenschaftlicher Politikberatung nicht im Eingriff in operative Politik, sondern in der frühzeitigen „Sozialisation“ von Apparaten und Politikern. Die Instrumente dafür (vom persönlichen Gespräch bis zu lesbaren, kurzen Vermerken) müssen entsprechend geschärft werden. Dieser Prozess findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern in einer Diskurswelt, in der neue und alte Medien eine große Rolle spielen. Strategische Politikberatung muss darüber nachdenken, wie sie Öffentlichkeit nutzen kann.
- Wissenschaft muss reflektieren, wann sie den Boden wissenschaftlicher Analyse verlässt. Theoriebildung und Methoden – beides unabdingbar für ihre Selbstdefinition als Wissenschaft und ihre Fortentwicklung – spielen für Politikberatung keine Rolle. Dennoch sind sie unverzichtbar zur eigenen Urteilsbildung. Doch die Interaktion mit Politikern und Stäben führt oft dazu, dass auch der Berater Kompromisse eingeht und seine Lösungsvorschläge den Erwartungen der Politik anpasst. Dann stellt sich die Frage, wann die Beratung ihren wissenschaftlichen Charakter einbüßt.
- Der Illusion, Beratung durch Wissenschaft führe zu einer „richtigen“ oder gar einer erfolgreichen Politik, sollten aber weder der Berater noch der Beratene erliegen. Wissenschaftlichkeit ist nicht gleichbedeutend mit Wahrheit. Und die Anwendung wissenschaftlicher Verfahren führt nicht dazu, dass Politik richtig handelt. [58]
Politikberatung durch Wissenschaftler ist notwendig. Die demokratisch legitimierten Institutionen haben Anspruch auf alle Informationen, die für sachgerechtes Handeln erforderlich sind. Die Vorstellung, dass Wissenschaftler ob ihrer überlegenen Einsicht Politik anleiten sollten – eine Idee, die möglicherweise aus Platons „Politeia“ entliehen ist, in dessen idealem Staat Staatsgewalt und Philosophie in eins fällt[59] –, entspricht nicht den Grundsätzen eines demokratisch verfassten Gemeinwesens. Insofern sollte sich ein Wissenschaftler dem Beratungsprozess nicht entziehen, er sollte sein Wissen sowohl der Exekutive – den Regierenden und ihren Stäben – als auch der Legislative und der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Er sollte sich und seine Möglichkeiten, den politischen Prozess zu gestalten, aber nicht überschätzen. Vielmehr liegt – wie Streeck und andere Autoren es beschrieben haben – die Chance in der Beteiligung am gesellschaftlichen Diskurs und in der Stellungnahme zu relevanten Themen mit dem Ziel, wissenschaftlich gewonnene Information in die Debatten einzubringen.
Gert Wagner, Ökonom und Senior Research Fellow am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, betont denn auch das Primat der Politik, die allein legitimiert ist, Entscheidungen zu treffen:
"Die Rolle der Wissenschaft bei politischen Entscheidungen ist deutlich begrenzt. Diese Begrenzung wird auf beiden Seiten des Beratungsbetriebs gerne ignoriert: von Politikern, die nach einer vermeintlich unangreifbaren Legitimation für ihre Entscheidungen suchen, und von Wissenschaftlern, die gerne die Welt verändern würden – oder auch nur Mittel für ihre Forschung rechtfertigen und akquirieren wollen. Aber: Politische Entscheidungen sind Wertentscheidungen, die nur die Politik selbst demokratisch legitimiert treffen kann."[60]
In der res publica von heute genießt die Legitimation durch demokratisches Verfahren gegenüber der Legitimation durch wissenschaftliche Rationalität den Vorrang. Es ist die Politik, die die Verantwortung für das Handeln trägt. Wissenschaftliche Beratung ist „verantwortungslos“.
[1] Max Weber: Wissenschaft als Beruf 1917/1919. Politik als Beruf 1919. Tübingen 1994. [= Studienausgabe der Max-Weber-Gesamtausgabe. Band I/1].
[2] Ebd., S. 14.
[3] Ebd., S. 36.
[4] Ebd.
[5] Ebd., S. 76.
[6] Ebd., S. 79f.
[7] Ebd., S. 19f.
[8] Jürgen Zöllner: Wie die Wissenschaft sich selbst schadet. Ein Gastbeitrag. Tagesspiegel, 13.1.2019, <www.tagesspiegel.de/wissen/vertrauensverlust-wie-die-wissenschaft-sich-selbst-schadet/23836930.html>. Der habilitierte Mediziner Zöllner war 1991–2006 Minister für Bildung und Wissenschaft in Rheinland-Pfalz und 2006–2011 Wissenschaftssenator in Berlin.
[9] Jürgen Habermas: Verwissenschaftlichte Politik und öffentliche Meinung, in: Ders.: Technik und Wissenschaft als Ideologie. Frankfurt/Main 1968, S. 120–145. – Klaus von Beyme: Politik und wissenschaftliche Information der Politiker in modernen Industriegesellschaften, in: Ders. (Hg.): Der Vergleich in der Politikwissenschaft. München 1988, S. 347–368. – Dirk Messner: Wissenschaftliche Politikberatung: einige Anmerkungen zu einem schwierigen Verhältnis, in: Gerhard Hirscher, Karl-Rudolf Korte (Hg.): Information und Entscheidung: Kommunikationsmanagement der politischen Führung. Wiesbaden 2003, S. 163–183. – Wolfgang Bonß: Zwischen Verwendung und Verwissenschaftlichung. Oder: Gibt es eine „Lerngeschichte“ der Politikberatung? In: Zeitschrift für Sozialreform, 1–2/2004, S. 32–45. – Svenja Falk. u.a. (Hg.): Handbuch Politikberatung. Wiesbaden 2006. – Erich Fröschl u.a. (Hg.): Politikberatung zwischen Affirmation und Kritik. Wien 2007. – Peter Weingart, Justus Lentsch: Wissen – Beraten – Entscheiden. Form und Funktion wissenschaftlicher Politikberatung in Deutschland. Weilerswist 2008. – Wolfgang Streeck: Man weiß es nicht genau: Vom Nutzen der Sozialwissenschaften für die Politik. Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Köln. MPIfG Working Paper 09/11, October 2009 <www.mpifg.de/pu/workpap/wp09-11.pdf>.
[10] Von Beyme, Politik und wissenschaftliche Information [Fn. 9], hier S. 363f.
[11] Matthias Basedau, Patrick Köllner: Area studies, comparative area studies, and the study of politics. Context, substance, and methodological challenges, in: Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft, 1/2007, S. 105–124. – Robert H. Bates: Area studies and the discipline: A useful controversy? In: Political Science and Politics, 2/1998, S. 166–169. – Katja Mielke, Anna-Katharina Hornidge: Crossroads Studies: From Spatial Containers to Interactions in Differentiated Spatialities „Area Studies“. Discussion paper of the Research Network Crossroads Asia. Bonn 2014, <http://crossroads-asia.de/fileadmin/userupload/publications /Xroads WorkingPaper15MielkeHornidgeCrossroadsStudi.pdf>. – Christopher Shea: Political Scientists Clash over Value of Area Studies, in: The Chronicle of Higher Education, 1/1997, S. A13–14. Hier sei noch einmal betont, dass es Regionalforschung heißt, nicht Regionalwissenschaften und Osteuropaforschung, nicht Osteuropawissenschaft. Denn die Befassung mit einer Region begründet keine wissenschaftliche Disziplin mit eigener Methode, vielmehr müssen verschiedene Disziplinen mit ihren spezifischen methodischen Ansätzen zusammenarbeiten, um Entwicklungen in einer Region zu erforschen und gemeinsam zu erklären.
[12] Heinrich Vogel, der langjährige Direktor des „Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien“ (BIOst), sprach stets von „politikbegleitender Forschung“ und nicht von „Politikberatung“. Letzteres erschien ihm in der Ära der Kanzler Helmut Schmidt und Helmut Kohl, die an externer Beratung kaum interessiert waren, als irreführende Bezeichnung, die seine Erfahrungen nicht widerspiegelte.
[13] Dazu die Konferenzberichte von Helmut König, in: Osteuropa, 10/1986, S. 836–863; 9/1987, S. 675–703; 9/1988, S. 835–856; 9/1991, S. 847–863; 9/1994, S. 862–885; 9/1995, S. 833–853; 11/1996, S. 1136–1159; 5/1998, S. 467–484. Das diskursive Format der Veranstaltung war Günther Wagenlehner geschuldet, einem Osteuropa-Soziologen, der als Stellvertretender Leiter der Abteilung Psychologische Verteidigung im Führungsstab der Bundeswehr tätig war und die Konferenzen aus seinem Etat finanzierte. Wagenlehner erzählte auf der Tagung 1987, dass er der Redaktion bei Gewährung der Mittel die Bedingung gestellt habe, es dürfe keine „öden“, langen Vorträge geben.
[14] Die AkPSVBw wurde 1990 in die Akademie der Bundeswehr für Information und Kommunikation (AIK) umstrukturiert.
[15] <www.schlangenbader-gespraeche.de>.
[16] Arnold Buchholz: Die Polarisierung in der Osteuropaforschung, in: Osteuropa, 7/1989, S. 649–651.
[17] <www.spiegel.de/spiegel/print/d-13521510.html>, 14.5.2019.
[18] Erklärung des Bundeskanzlers zum Konflikt in Tschetschenien. Bulletin 03-95, 13.1.1995, <www.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/erklaerung-des-bundeskanzlers-zum-konflikt-in-tschetschenien-790566>.
[19] Uwe Halbach: Jelzins Krieg im Kaukasus. I: „… wohl nicht gegen Rußland?“ In: Aktuelle Analysen des BIOst, 1/1995. – Jelzins Krieg im Kaukasus. II: Motivation, Rechtfertigungen, Ängste. Aktuelle Analysen des BIOst, 2/1995.
[20] Heinz Timmermann: Tschetschenien, Rußland und Europa, I: Europarat und Europäische Union zu Moskaus Krieg im Kaukasus. Aktuelle Analysen des BIOst, 33/1995. – Ders.: Tschetschenien, Rußland und Europa. II. Die Reaktion Moskaus auf die Kritik von Europarat und Europäischer Union. Aktuelle Analysen des BIOst, 34/1995.
[21] Dieter Heinzig: Hat sich Tschetschenien 1991 rechtswirksam von Rußland losgetrennt? Aktuelle Analysen des BIOst, 5/1995.
[22] Daniel S. Hamilton, Kristina Spohr: Open Door: NATO and Euro-Atlantic Security after the Cold War, Washington, D.C.: Foreign Policy Institute / Henry A. Kissinger Center for Global Affairs, Johns Hopkins University SAIS 2019, <http://transatlanticrelations.org/wp-content/uploads/2019/04/Open-Door_full.pdf>.
[23] Colin Powell berichtet, er habe diesen Gedanken schon im Mai 1989 geäußert: Colin Powell, (with Joseph E. Persico): My American Journey. New York 1995, S. 390.
[24] Volker Rühe: Opening NATO’s Door, in: Daniel S. Hamilton u.a.: Open Door [Fn. 22], S. 217–233, <http://transatlanticrelations.org/wp-content/uploads/2019/04/10-Ruhe.pdf>.
[25] Ulrich Weisser: Strategie als Berufung. Erinnerungen und Gedanken eines Offiziers an der Nahtstelle zur Politik. Bonn 2011, S. 136ff.
[26] Volker Rühe: Shaping Euro-Atlantic Policies: A Grand Strategy for a New Era, in: Survival, 2/1993, S. 129–137. – Rühe, Opening [Fn. 24], S. 220ff. – Weisser, Strategie [Fn. 25], S. 137f.
[27] Rühe, Opening [Fn. 24], S. 226 [im Original Englisch].
[28] Ronald D. Asmus, Richard L. Kugler, F. Stephen Larrabee: NATO Expansion: The Next Steps, in: Survival, 1/1995, S. 7–33.
[29] Der britische Militärhistoriker Max Hastings charakterisierte die RAND Corporation in Santa Monica als „gemeinnützige Organisation, die erhebliche Mittel von der Air Force erhielt. Sie beschäftigte kluge Leute, war aber nie bereit, mit den Vorgaben jener zu brechen, die die Rechnung bezahlten.“ Max Hastings: Vietnam: An Epic Tragedy, 1945–1975. London 2019, S. 122.
[30] Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien (Hg.): Zwischen Krise und Konsolidierung. Gefährdeter Systemwechsel im Osten Europas. München, Wien 1995. – Dass. (Hg.): Der Osten Europas im Prozeß der Differenzierung. Fortschritte und Mißerfolge der Transformation. München, Wien 1997. – Heinrich Vogel (Hg.): Rußland als Partner der europäischen Politik. Berichte des BIOst, 8/1996.
[31] Hans-Henning Schröder: NATO-Öffnung und russische Sicherheit, in: Osteuropa, 5/1997, S. 421–430, hier S. 430. Diesem Aufsatz lag die Aktuelle Analyse des BIOst, 2/1997 zugrunde.
[32] Helmut Schmidt: Außer Dienst. Eine Bilanz. München 22008, S. 40f.
[33] Die Ergebnisse dieses Projektes wurden als SWP-Papier veröffentlicht: Hans-Henning Schröder, Denis Tull (Hg.): Europäische Energiesicherheit 2020. Szenarien für mögliche Entwicklungen in Europa und seinen energiepolitisch wichtigsten Nachbarregionen. SWP-Studie 4/2008, <www.swp-berlin.org/publikation/europas-energiesicherheit-2020/>.
[34] Planungsstab des Auswärtigen Amtes, Berlin in Kooperation mit der Stiftung Wissenschaft und Politik: Russland 2012 – Partner oder Gegenmacht? Eine Szenarioanalyse, Berlin: Ms., 4. November 2007 [Archiv des Autors].
[35] Frank-Walter Steinmeier: Auf dem Weg zu einer europäischen Ostpolitik. Die Beziehungen Deutschlands und der EU zu Russland und den östlichen Nachbarn. Rede des Bundesministers des Auswärtigen, Dr. Frank-Walter Steinmeier, anlässlich der Podiumsdiskussion bei der Willy-Brandt-Stiftung am 4. März 2008, <www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom /080304-bm-ostpolitik/219748>. – Deutschland für Modernisierungspartnerschaft mit Russland. Deutsche Welle, 15.5.2008, <https://p.dw.com/p/E0Tf, 18. Mai 2019>.
[36] Hans-Joachim Spanger: Modernisierungspartnerschaft zwischen EU und Russland. Deus ex machina? In: Strategie und Sicherheit, 1/2012, S. 395–408. – Wladislaw Inosemzew: Modernisierungspartnerschaft Russland-EU: Wie umsetzen? Russlands Perspektiven 09/2010, <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/moskau/07452.pdf>.
[37] Ralf Beste, Uwe Klussmann, Gabor Steingart: Kalter Frieden, in: Der Spiegel, 36/2008, S. 20–28.
[38] [Medvedev, D.A.]: Vystuplenie na vstreče s predstaviteljami političeskich, parlamentskich i obščestvennych krugov Germanii. 5 ijunja 2008 goda, Berlin, <www.kremlin.ru/events/president/transcripts/comminitymeetings/320>.
[39] Heiko Pleines, Hans-Henning Schröder (Hg.): Der bewaffnete Konflikt um Südossetien und internationale Reaktionen. Bremen 2008, <www.forschungsstelle.uni-bremen.de/UserFiles/ file/06-Publikationen/Arbeitspapiere/fsoAP97.pdf >. – Hans-Henning Schröder (Hg.): Die Kaukasus-Krise. Internationale Perzeptionen und Konsequenzen für deutsche und europäische Politik. SWP-Studie, 25/2008, <www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/ studien/2008_S25_shh_ks.pdf>. – Jim Nichol: Russia-Georgia Conflict in South Ossetia: Context and Implications for U.S. Interests, Washington, D.C 2008 [= CRS Report for Congress. Order Code RL34618. Sept. 22, 2008, <www.fas.org/sgp/crs/row/RL 34618.pdf>. – Roy Allison: Russia resurgent? Moscow’s campaign to „coerce Georgia to peace“, in: International Affairs, 6/2008, S. 1145–1171.
[40] Vystuplenie na Konferencii po mirovoj politike. 8 oktjabrja 2008 goda, Francija, Ėvian <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/1659>. – Zum Kontext Andrei Zagorski: Der russische Vorschlag für einen Vertrag über europäische Sicherheit: von der Medwedew-Initiative zum Korfu-Prozess, in: IFSH (Hg.): OSZE-Jahrbuch 2009. Baden-Baden 2010. S. 49–67, <https://ifsh.de/file-CORE/documents/jahrbuch/09/Zagorski-dt.pdf>.
[41] Rossija, vpered! Stat’ja Dmitrija Medvedeva. 10 sentjabrja 2009 goda, 10.9.2009, <http://kremlin.ru/events/president/news/5413>.
[42] Memo SWP-Arbeitskreis „Europäische Sicherheitsordnung“ von Margarete Klein und Solveig Richter. SWP, 20.10.2009 [Archiv des Autors].
[43] Margarete Klein, Solveig Richter: Russland und die euro-atlantische Sicherheitsordnung. Defizite und Handlungsoptionen. SWP-Studie, 34/2011, <www.swp-berlin.org/fileadmin/ contents/products/studien/2011_S34_kle_rsv_ks.pdf>.
[44] Habermas, Verwissenschaftlichte Politik [Fn. 9]. – von Beyme, Politik [Fn. 9]. – Eva Kreisky: Politikerberatung als neuer Beruf. Anzeichen neoliberaler Einbindung von Politikwissenschaft, in: Fröschl, Politikberatung [Fn. 9], S. 11–46. – Weingart, Wissen – Beraten – Entscheiden [Fn. 9]. – Streeck, Man weiß es nicht genau [Fn. 9]. – Messner, Wissenschaftliche Politikberatung [Fn. 9].
[45] Bonß, Zwischen Verwendung und Verwissenschaftlichung [Fn. 9], S. 32.
[46] Leitlinien Politikberatung [Fn. 9], S. 13.
[47] Messner, Wissenschaftliche Politikberatung [Fn. 9], S. 163.
[48] Ebd., S. 171.
[49] Bonß, Zwischen Verwendung und Verwissenschaftlichung [Fn. 9], S. 41.
[50] Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. Werke, Band 7. Frankfurt/Main 1970, S. 27f.
[51] Stephan Bröchler, Helmut Elbers: Hochschulabsolventen als Mitarbeiter des Parlaments: Politikberater oder Bürohilfskräfte? Ergebnisse einer internetgestützten Befragung der persönlichen wissenschaftlichen Mitarbeiter der Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Polis, 52/2001, <www.fernuni-hagen.de/POLINST/pdf-files/polis-Heft52.pdf>, S. 5f.
[52] Nina Grunenberg: Die Mächtigen schlau machen. Einflüstern, steuern, manipulieren. In der Hauptstadt boomt das Geschäft der Besserwisser. Die Zeit, 28/2001.
[53] Von Beyme, Politik [Fn. 9], S. 352.
[54] Streeck, Man weiß es nicht genau [Fn. 9], S. 7.
[55] Von Beyme, Politik [Fn. 9], S. 355ff.
[56] Zöllner, Wie die Wissenschaft sich selber schadet [Fn. 8].
[57] Kreisky, Politikerberatung [Fn. 44], S. 25.
[58] Michael Ignatieff: Getting Iraq Wrong. New York Times, 5.8.2007, <www.nytimes.com /2007/08/05/magazine/05iraq-t.html?_r=1&oref=slogin&pagewanted=print>. „Ich habe lernen müssen, dass ein gutes Urteil in der Politik anders aussieht als ein gutes Urteil im intellektuellen Leben […] Busfahrer können ein klareres Verständnis davon haben, um was es geht, als Nobelpreisgewinner.“
[59] Platon: Politeia. Sämtliche Werke V. Frankfurt/Main 1991, S. 411, et passim.
[60] Gerd Wagner: Politikberatung braucht Selbstbeschränkung. Handelsblatt, 15.4.2008, S. 8.
Volltext als Datei (PDF, 328 kB)