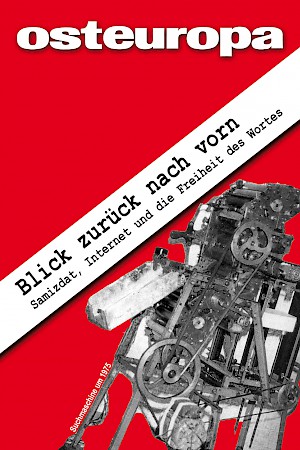Der Dissens und die politische Theorie
Lehren aus Ostmitteleuropa
Volltext als Datei (PDF, 317 kB)
Abstract in English
Abstract
Der Dissens der 1970er und 1980er Jahre in Ostmitteleuropa fügt sich auf besondere Weise in die Geschichte abweichenden Denkens ein. Er lieferte auch einen substantiellen Beitrag zur politischen Theorie. Das wichtigste Vermächtnis des ostmitteleuropäischen Dissens ist die Wirksamkeit der Gewaltlosigkeit auf politischen Wandel. Die Erfahrungen von 1989 haben die vergleichende Untersuchung von Revolutionen „revolutioniert“. Doch der Beitrag des Dissens wird häufig eindimensional oder falsch verstanden.
(Osteuropa 11/2010, S. 5–28)
Volltext
Im Vorwort zu ihrer Aufsatzsammlung Zwischen Vergangenheit und Zukunft zitiert die politische Philosophin Hannah Arendt den französischen Resistance-Dichter René Charder: „Notre Héritage n’est précédé d’aucun testament“ – „Unserer Erbschaft ist keinerlei Testament vorausgegangen“. Mit dieser Metapher wollte Arendt die theoretischen Probleme der Räume zwischen dem Handeln verständlich machen. Die europäischen Widerstandsbewegungen – zu denen Arendt nicht nur den maquis, sondern auch die Pariser „Freiheitskämpfer“ von 1789 und die ungarischen von 1956 zählte – hatten „ihren Schatz verloren“. Für sie ist dieser vergängliche „Schatz“ die öffentliche Freiheit und Menschlichkeit, die durch die Beteiligung an revolutionärer Emanzipation gewonnen, im Arendtschen Sinne der vita activa gar erst geschaffen wurden.
In diesem Dilemma befinden sich über zwanzig Jahre nach 1989 die ehemaligen Aktivisten als Zeugen und die Wissenschaftler, die an diesem elektrisierenden Ereignis oft auch als teilnehmende Beobachter beteiligt waren. Wir stehen vor einem Arendtschen Rätsel: zwischen Vergangenheit und Zukunft. Wir wissen, dass die „Inseln der Freiheit“, wie sie die Dissidentengemeinden in Ostmittel- und Osteuropa repräsentieren, ungeheure Folgen für Ausmaß und Art der politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen hatten, müssen uns mit dieser Realität aber analytisch erst noch anfreunden. Und doch ist der Ort zwischen Vergangenheit und Zukunft durchaus produktiv. Arendt sah in solchen Intervallen die Möglichkeit eines „Augenblicks der Wahrheit“, der erneuten Untersuchung der Art, wie wir in die Zeit „eingefügt“ sind, ohne Hybris, in vollem Bewusstsein unserer Nacktheit – ohne jede verständnisvolle oder deutende Maske. Über zwei Jahrzehnte nach 1989 ist die Zeit vorbei, in der man die Rolle der Dissidenten beim Fall des Kommunismus und Ende des Kalten Krieges rasch und triumphierend erklären konnte. Bevor die Vergangenheit aber wirklich vergangen ist, können wir ihr mit unseren lebendigen Erinnerungen und Erfahrungen noch einen Sinn geben und diese Erfahrungen in die longue durée im Sinne Fernand Braudels einfügen, so dass ein Testament geschrieben werden kann.
Weniger metaphysisch ausgedrückt: Wir brauchen eine Analyse, welche die ostmittel- und osteuropäischen Dissidenten nicht nur in der Geschichte ihrer Staaten und Regionen verortet, sondern in der größeren Geschichte von Dissens und substaatlichem Widerstand gegen Autoritarismus. Dann lässt sich das Vermächtnis der Dissidenten dieser Zeit und dieses Ortes für die globale Politik der Zukunft besser würdigen. Zudem war es angesichts des Doppelphänomens von Tempo und Globalisierung der Kommunikation wohl nie dringender oder schwieriger als heute, die jüngste Vergangenheit zu verstehen und in die ältere Geschichte einzuordnen. Anders als in früheren Zeiten, in denen, wie Marx sagte, der Alptraum der Vergangenheit das Denken der Lebenden belastete, eignen sich Gegenwart und Zukunft die Vergangenheit heute mit einer Geschwindigkeit und Selektivität an, die gleichzeitig verführerisch und gefährlich ist, denn allzu häufig fehlt das Element des Verstehens. Nie klang Hegels Wort über die Eule der Minerva, die ihren Flug bei Sonnenaufgang beginnt, prophetischer.
WAS HEIßT DISSENS?
Die politische Theorie und einschlägige Lexika definieren „Dissens“ sowohl als abweichende Meinung oder Einstellung zu geltenden Normen oder rechtlich-politischen Strukturen als auch als Ablehnung dieser Normen und Strukturen. Historisch tauchte Dissens erstmals als religiöser Nonkonformismus nach der Reformation auf; eine Folge der europäischen Religionskriege. Im englischen Sprachraum sind die klassischen Beispiele die nonkonformistischen religiösen Sekten, die Dissenters, im England und Schottland des 17. Jahrhunderts. Auf einem Kontinuum von Widerstand hatte „Dissens“ einen besonderen Charakter: er gehörte dazu, war aber nicht so erkennbar konfrontativ wie die organisierte Opposition.
Widerstand als umfassendere Kategorie kann öffentlich oder privat sein, textuell oder performativ. Lynne Viola hat in ihrer Untersuchung über das Leben in der UdSSR in den 1930er Jahren Widerstand in einem breiten Sinne diskutiert, das von Zugeständnissen, Anpassung und Apathie bis zu innerer Emigration, Opportunismus und positiver Unterstützung reicht. Ähnlich, wenn auch stärker theoretisch ausgerichtet, verhilft James C. Scotts Modell der „verborgenen Transkripte“ zu verstehen, wie sich diskursive Praktiken „hinter den Kulissen“ in öffentlichen Dissens verwandeln lassen – als Moment des „Bruchs“, der revolutionäre Implikationen hat. Scott zählt in seiner Analyse Gerüchte, Klatsch, Volksmärchen, Lieder, Gesten, Witze, das Theater der Machtlosen zu den „verborgenen Transkripten“ – also alles, was im Schutz der Anonymität eine Kritik der Macht bedeutet. Scotts „verborgene Transkripte“ des Widerstands repräsentieren diskursive Praktiken – Gesten, Sprache, Aktionen – die meist aus den „öffentlichen Transkripten“ normaler Machtbeziehungen zwischen den autoritär Herrschenden und den Beherrschten und Unterdrückten ausgeschlossen sind. Verborgene Transkripte repräsentieren den Bereich der Politik, der hinter den Kulissen liegt, was hier bedeutet: außerhalb des Bereichs des Parteienstaats. Die Gefahr liegt natürlich darin, dass die offizielle Analyse, die sich auf öffentliche Transkripte verlässt, die Beherrschten generell als bereitwillige und sogar begeisterte Partner ihrer Unterwerfung versteht.
Scott sieht den explosivsten Bereich der Politik, den potentiellen „revolutionären Augenblick“, in dem Moment, in dem sich der Bruch zwischen dem öffentlichen und dem verborgenen Transkript vollzieht. In Ostmitteleuropa steht dafür vor allem Havels fiktiver Gemüsehändler, der das Schild „Arbeiter aller Länder, vereinigt euch!“ aus seinem Schaufenster entfernte und damit den Unterschied zwischen dem Offiziellen, Öffentlichen und dem Verborgenen, Authentischen und Trotzigen verwischt. Dieser Gemüsehändler trotzt den an ihn gerichteten Erwartungen und führt den leeren semantischen Gehalt des Slogans vor. Scott und Havel sind sich einig, dass es der öffentlichen Verweigerung bedarf, um das verborgene Transkript öffentlich zu machen und privaten Widerstand in öffentlichen Dissens zu verwandeln. Scott weist darauf hin, dass „… die erste offene Erklärung des verborgenen Transkripts oft die Form des öffentlichen Bruchs mit einem etablierten Ritual öffentlicher Unterwerfung annimmt“.
Diese Analyse hilft, die vielfältige soziale Mobilisierung und die Gründe für die häufig unbeabsichtigte Verwandlung von Reformern in Revolutionäre zu verstehen. Gleichzeitig bietet er eine pragmatische Kritik an Gramscis Hegemonie-Theorie und dem Begriff des falschen Bewusstseins bei Marx, denn dabei handelt es sich um strukturalistische Theorien, die keine Erklärung für 1989–1991 bieten. Der gemeinsame Diskurs der verborgenen Transkripte wird in den Zwischenräumen der autoritären, dominanten und dominierenden Sozialordnung „geschaffen und entwickelt“. Genau dies geschah in den zivilgesellschaftlichen Organisationen und Bewegungen in den „Parallel-Polei“ Ostmittel- und Osteuropas. Aus dieser Perspektive ist es weit weniger überraschend, wenn die bislang scheinbar unterwürfige, ruhige und folgsame Bevölkerung sich erhebt und durch Massenwiderstand und Mobilisierung die Gesellschaft kollektiv in die öffentliche Opposition zum Staat katapultiert.
Mit Scotts Erkenntnis wird auch klarer, dass Aufstände nicht einfach ausbrechen, sondern eine lange Geschichte haben, deren „aktive gesellschaftliche Orte“ erkannt werden müssen, in denen die verborgenen Transkripte „entwickelt und genährt“ wurden. Ein ostmitteleuropäisches Beispiel sind die in das kollektive polnische Gedächtnis an den Widerstand gegen den Kommunismus vor 1980/81 eingeschriebenen Daten 1956, 1968, 1970 und 1976. Es gab eine lange Vorgeschichte – bewahrt im populären Gedächtnis und in einer nationalen Kultur von Helden, Märtyrern und Schurken früherer Episoden, aber auch als kollektiver Lernprozess. Polen ist deshalb ein so gutes Beispiel, weil der Gedanke einer Koalition von „Arbeitern“ und „Intellektuellen“, die sowohl 1968 als auch 1970 nicht existierte, im „Komitee zur Verteidigung der Arbeiter“ (Komitet Obrony Robotników; KOR) evident wurde und mit der Solidarność massenhafte Früchte trug.
Auch wenn Widerstand im umfassenden Sinne Alltagsaktivitäten unbedingt einschließt, wird er politisch durch seinen öffentlichen Charakter. Krankfeiern, absichtlich geringe Produktivität, Rückzug in die Privatsphäre – all das lässt sich als Form des Widerstands bezeichnen, nicht aber als Form des Dissens. In gewissem Sinne erfordert Dissens ein Leben „als ob“, um es mit Havels berühmt gewordenen Worten zu sagen. Aber ein umfassenderer Blick auf Widerstand kann helfen, Dissens im breiteren Sinne als Gipfel der Unzufriedenheit mit dem Regime zu verorten.
Außerdem ist die Trennlinie zwischen Widerstand und Dissens nicht klar umrissen, sondern lässt sich eher als Kontinuum oder Spektrum verstehen. Am „Widerstands“-Pol dieses Kontinuums können Aktivitäten wie ständiges Krankfeiern, Alkoholismus oder Drogensucht stehen, aber auch private Reisen und Sportveranstaltungen anstelle von Veranstaltungen, die von offizieller oder Gewerkschaftsseite organisiert werden. In der Mitte des Spektrums stehen private oder familiäre Diskussionen über eine alternative Geschichtsschreibung, heimliches Hören verbotener Radiosendungen, Texte, die „für die Schublade“ geschrieben, aber gelegentlich auch anderen gezeigt werden, Witze in der Öffentlichkeit oder die Lektüre von Samizdat-Veröffentlichungen. Unterstützeraktionen und Aktivitäten in der „Grauzone“ – eine Petition unterschreiben, eine Pilgerreise machen, Diskussionen mit Freunden über eine bestimmte Radiosendung oder das Verbreiten von Nachrichten – gehören schon in die „Dissens“-Hälfte, an deren Pol dann etwa Produktion oder Vertrieb von Samizdat-Schriften, öffentlicher Protest, aktive Mitgliedschaft in unabhängigen, der Kontrolle des Parteienstaates entzogenen Gruppen, anzusiedeln sind – stets verbunden mit der Gefahr, vom Regime verfolgt oder verhaftet zu werden. Manche Aktivitäten erhielten wegen ihres Massencharakters öffentlichen oder politischen Status, zum Beispiel die „Abstimmung mit den Füßen“ der vielen tausend Ostdeutschen, die Anfang der 1950er Jahre in den Westen und im Sommer und Frühherbst 1989 über Ungarn und die Tschechoslowakei flohen.
DIE URSPRÜNGE DES POLITISCHEN DISSENS
Dissens gehört zum Kanon des politischen Denkens, dessen früheste Vertreter selbst Dissidenten waren. Das kanonische Narrativ vom Beharren auf der Wahrheit gegenüber der Macht nahm seinen Anfang mit Sokrates, der in seinem Prozess darauf bestand, im Dialog die Wahrheit zu erforschen. Wie Leo Strauss zeigt, gehörte Verfolgung immer zur Kunst des Schreibens und Philosophieren – für die antiken und mittelalterlichen Autoritäten war die Feder genauso gefährlich wie das Schwert. Ein Dissident befürwortete nicht nur alternative Vorstellungen, er stellte die herrschenden politischen Strukturen in Frage, was in der Sprache des 20. Jahrhunderts meint: Aus Antipolitik wurde zwangsläufig Politik.
Aber erst mit dem Aufstieg und der Konsolidierung des modernen Staats nach dem Westfälischen Frieden in Europa beginnt die wahre Geschichte des zeitgenössischen Dissens, und der Gedanke einer gesetzlich geschützten Meinungsfreiheit ist eng mit der Entwicklung des Liberalismus verbunden. Der Schlüsseltext ist John Lockes Brief über die Toleranz (Epistola de Tolerantia). Wie das frühmoderne Verständnis von Toleranz generell handelt auch dieser Text primär von religiösem Dissens. Lockes Brief verteidigte spezifisch die religiöse Toleranz, er sagt nichts über Rede- und Meinungsfreiheit, die wir mit Dissens im umfassenderen Sinne verbinden. Da aber christliche Sekten oft nicht nur wegen ihrer religiösen Behauptungen als Dissidenten wahrgenommen wurden, sondern weil sie sich von vorherrschenden gesellschaftlichen und politischen Normen verabschiedeten, gelten die Argumente, mit denen Locke die Irrationalität eines erzwungenen Glaubens und die Grenzen staatlicher Macht bei der Unterwerfung des Glaubens unter das staatliche Diktat belegte, auch dann, wenn man sie auf autoritäre Regimes anwendet. Für Locke gehörte Überzeugung in den Bereich der menschlichen Vernunft und nicht in den Bereich des Staates:
"überzeugen ist nicht befehlen, der Druck von Gründen nicht der von Strafen. Zu letzteren hat allein die Staatsgewalt ein Recht; für das andere genügt guter Wille als Autorität. Jeder Mensch hat eine Befugnis, einen andern zu ermahnen, aufzufordern, des Irrtums zu überführen und ihn durch Vernunftgründe auf die Seite der Wahrheit zu ziehen; aber Gesetze zu geben, Gehorsam zu empfangen und mit dem Schwerte zu zwingen, kommt niemandem zu als der Obrigkeit."
Aus der von Locke begründeten Tradition entwickelte sich eine Reihe von praktischen und theoretischen Prinzipien, die letztlich mit dem Liberalismus assoziiert wurden. Erstens wurde die zunächst in Glaubensfragen geforderte Toleranz auf andere Aspekte des Lebens ausgedehnt – gesellschaftliche Praxis, Kunst- und andere Ausdrucksformen, heute auch auf die aktive Integration diverser, ja sogar widerstreitender religiöser und kultureller Praktiken in multikulturellen Gesellschaften. Und auch wenn Dissens die Grenzen der Legalität überschreiten kann, kann Toleranz ihn doch zweitens durch intelligenten und taktischen Verzicht auf allzu harte Rechtsmittel und Gewalt oder durch eine strafrechtliche (mildernde) Unterscheidung zwischen zivilem Ungehorsam und typisch kriminellen Taten begrenzen. In beiden Fällen darf man Toleranz nicht mit aktiver Zustimmung verwechseln. Drittens öffnet Toleranz diskursive, politische Wege jenseits der klassischen Orientierung an Rechten zu einer radikalen Form des Relativismus (kein Werte- oder Glaubenssystem hat größeren Anspruch auf Wahrheit oder gesellschaftlichen Vorteil als ein anderes) oder zu Argumenten für Pluralismus und Diversität, die bei kollidierenden Ansprüchen öffentliche, prozedurale Schiedsverfahren erfordern, geleitet von Verantwortung, Kooperation, Kompromiss und der oft stillschweigenden Annahme, dass manche Ansprüche grundlegender sind als andere und ihr Vorrang deshalb legitim sei. In anderen Worten: „Toleranz“ ist die Vorbedingung für komplizierte demokratische Abwägung. Man darf nicht vergessen, dass der Dissens bei seiner Verwandlung vom Religiösen ins Politische in der angelsächsischen Welt und Europa in der Regel eher als gefährlich verstanden wurde. Das Chaos, die Instabilität und Widerspenstigkeit, die er mit sich bringen konnte, wog schwerer als die Ideen oder Alternativen, die er bot.
Es bedarf noch viel theoretischer und historischer Arbeit, um den Dissens des ausgehenden 20. Jahrhunderts in dieser lange Tradition verorten und das Denken der ostmittel- und osteuropäischen Dissidenten als eigenständige politische Theorien ernst nehmen zu können. Eine wichtige praktische Erklärung für die geringe Forschung in diesem Bereich findet sich im postmarxistischen Charakter der ursprünglichen Arbeit der Dissidenten selbst, weil sie in einer Region entstand, die theoretisch durch den trüben Konformismus des Marxismus-Leninismus blockiert wurde.
Dennoch erkannten viele Dissidenten im Gefolge des polnischen Philosophen Leszek Kołakowski nicht nur den verzerrten Marxismus als fehlerhaft, sondern machten zunehmend die Marxsche Theorie selbst verantwortlich für eine Tradition, die den Dissens als reformistisch und ineffektiv und liberale Freiheiten als bürgerlich und zweitrangig gebrandmarkt hatte. Im 19. Jahrhundert war der Dissens angesichts der wirtschaftlichen Benachteiligung so nebensächlich, dass Marx liberale Freiheiten für bourgeois und sekundär hielt, weil sie (dank der Macht der Logik des Kapitals) die materiellen Bedingungen der Arbeiterklasse kaum berührten. Bei der Analyse von Entfremdung, Leid und effektiver Entrechtung wich Marx’ utopische Teleologie einem harten Realismus. Für ihn war Dissens nur Teil des größeren Klassenkampfs, und nur die unvermeidliche Revolution konnte die Lage der arbeitenden Massen dauerhaft verändern. Für gesellschaftliche Harmonie konnte nur die klassenlose und nicht die pluralistische Gesellschaft sorgen. Und schließlich entwertete Marx (gegen Hegel) sogar die Unterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft angesichts der alles bestimmenden Übermacht des Kapitals. Marx ignorierte also in Theorie und Praxis, dass es die Gesellschaft lange vor dem Kapital gegeben hatte. Damit ging auch ihre Rolle als Vermittler zwischen Staat und Individuum verloren.
Toleranz – von der Dissens abhängt – wurde bis in die 1980er Jahre mit wenigen Ausnahmen als unvereinbar mit sozialistischem Denken betrachtet. Im Westen wurde der Begriff mit Herbert Marcuses Begriff der „repressiven Toleranz“ assoziiert. Im Osten wurde Toleranz von den russischen Revolutionären und ihren Schülern rücksichtslos instrumentalisiert. In dieser Frage spielten ideologische Unterschiede zwischen Lenin, Stalin oder und Trockij keine Rolle.
Erst seit den Revolutionen von 1989 gibt es eine Debatte über die Rolle, die der Dissens und das gemeinsame Œuvre der Dissidenten für den Liberalismus gespielt hat. Jeffrey C. Isaac, Timothy Garton Ash, Ralf Dahrendorf und Jürgen Habermas diskutierten über die Neubelebung des Liberalismus im Westen als Vermächtnis der Dissidenten, wobei sie darunter vor allem die Bestätigung der vertrauten Grundlagen des Liberalismus verstanden und keineswegs neue Ideen oder Ansätze sahen. Den Dissidenten dagegen war es vor allem darum gegangen, eine andere Zivilgesellschaft zu schaffen, im Parteienstaat öffentlichen Raum zurückzuerobern und eine andere Art von Politik („Antipolitik“ im Sinne von György Konrád) zu praktizieren. Es ging den Dissidenten nicht primär um einen Regimewechsel. Erst nach 1989 wurde es zu einer ständigen Verführung, das dissidentische Handeln ex post facto so zu interpretieren. Im Mittelpunkt des Beitrags der Dissidenten zu einem substantiellen partizipativen demokratischen Liberalismus stehen die Verpflichtung auf gesellschaftliche Solidarität und Vertrauen, die tatsächliche Umsetzung der Menschenrechte, ein „starker“, auf Selbstermächtigung gestützter Verantwortungsbegriff, die Wiedergewinnung der Subjektivität und ein offenes, im Sozialen gründendes Gefühl, anderen genauso verpflichtet zu sein wie sich selbst. Kurz: die Theorie und Praxis des Dissens in Mittel- und Osteuropa weckte Themen zu neuem Leben, die für Locke und Hegel evident waren, aber von Marx geleugnet wurden. Damit kann die Arbeit der Dissidenten als ideologische Brücke zwischen dem politischen Denken des 18. und 19. Jahrhunderts und der Gegenwart sowie gleichzeitig als Beitrag zur demokratischen Theorie verstanden werden, beschäftigten sie sich doch mit Demokratisierung als Entwicklungsprozess in einem autoritären politischen Raum, statt sie als Gegebenheit zu sehen, die komplettiert werden muss.
Braucht Dissens also logisch den Liberalismus? Ein Individuum, das Rechte hat? Ja, aber nicht nur. Der monistische Liberalismus machte dem pluralistischen Liberalismus Platz, in dem divergierende Gemeinschaften auch ein politisches und rechtliches „Standing“ haben müssen. Dieses Verständnis von Dissens geht davon aus, dass Identitäten komplementär und widersprüchlich konstruiert sind – auf der Grundlage von Ethnie, Geschlecht, Glauben, historischer Erfahrung und gemeinsamer Unterdrückung (politisch und phänomenologisch, wie in Jan Patočkas Gedanken von der „Solidarität der Erschütterten“. Diese Sicht des Dissens ermächtigt in der Tat den Dissidenten, weil sie Dissens nicht als wesentlich destabilisierend, sondern als Ausdruck öffentlicher Realität versteht. Konstruiert man Bürgerschaft und Politik auf dieser Grundlage, vermeidet man nicht nur die zwangsläufigen Konflikte um widerstreitende Rechte, Ansprüche oder Gerechtigkeit, sondern kann ideologische und materielle Interessen anerkennen. Im Entscheidungsprozess lassen sich vielfältige und widersprüchliche Stimmen einbinden und an der Entscheidung teilhaben. Strukturell ist das auf vielfältigen, sich gegenseitig nicht ausschließenden Wegen möglich – über stabile Parteiensysteme, Korporatismus, Konkordanzmodelle zur Kooperation politischer Eliten, die diverse Gemeinschaften vertreten, durch föderale Ansätze, progressive oder umverteilende Besteuerungsmodelle oder eine substantielle Verankerung des Gleichheitsgedankens.
Wenn Dissens also ein philosophisches und praktisches Nebenprodukt des Liberalismus ist, ist er auch intrinsisch verwandt mit Freiheitstheorien und Annahmen über das Wesen und die Freiheit des Menschen. Schon John Stuart Mills berühmter Aufsatz Über die Freiheit geht davon aus, dass die abweichende Meinung ein Schlüsselargument für Freiheit ist, insbesondere für Meinungsfreiheit. Mill meint, man könne nie sicher sein, dass eine unterdrückte Meinung falsch ist, und selbst wenn man sich sicher sein sollte, sei doch der Prozess der Unterdrückung selbst falsch. Dem Diskussionsverbot liegt der gefährliche „Anspruch meiner eigenen Unfehlbarkeit“ zugrunde. Verderblicher noch sei die stillschweigende Annahme, man könne Individuen keinen potentiellen Unwahrheiten aussetzen, da sie nicht urteilsfähig seien. Folgt man Mill, dann verstärken die Prozesse und Produktionen des Samizdat nicht nur in der Praxis seine Argumente über freie Meinungsäußerung als Fundament der politischen Freiheit, sondern bedeuteten nichts weniger als die erneute Bekräftigung menschlicher Urteilsfähigkeit.
Fassen wir zusammen: Man muss den ostmittel- und osteuropäischen Dissens im Kontext längerfristiger, umfassenderer politiktheoretischer Debatten über Toleranz und Dissens, Rechte und ihre Inanspruchnahme, Reformismus und Revolution analysieren. Interessanterweise erreichte der ostmittel- und osteuropäische Dissens seinen Höhepunkt, als er über die behauptete Verfolgung und die legale Verteidigung hinaus zur „gesellschaftlichen Selbstverteidigung“ überging, wie es bei KOR hieß, und ihn damit nicht nur zur Bewusstseinsveränderung, sondern zur praktischen Verteidigung partikularer Gemeinschaften in alternativen Zivilgesellschaften nutzte. Folgt man der Analyse von Václav Benda, waren es diese „Parallel-Polei“, die die Entwicklung und Förderung von Netzwerken ermöglichte, die von sozialem Vertrauen, Lernen und Aushandeln geprägt waren. Daraus entstand öffentliches Handeln im Arendtschen Sinne: als Erweiterung der Freiheit. Die Koalition aus Arbeitern und Intellektuellen in Polen, repräsentiert durch KOR und später Solidarność, die inhärente politische und soziale Diversität der Charta 77 und die Art, wie sich die überwiegend urbanen Intellektuellen in Budapest über ihre gesellschaftlichen und politischen Erfahrungen hinaus auf frühere Generationen (insbesondere die „1956er“) und die ungarischen Minderheiten im Ausland bezogen, all das sind Anzeichen für den langen pluralistischen und inklusiven Prozess, der dem Dissens inhärent ist. In all diesen Fällen lieferte die Erfahrung des Dissens einen praktischen Beitrag zur Konstruktion eines nicht nur demokratischen und liberalen, sondern pluralistischen Modells.
DISSENS UND GEWALTLOSIGKEIT
Der Frage des Privateigentums, der konterrevolutionäre Kampf nach 1789 um die Bewahrung von Privilegien und die Entstehung der Arbeiterklasse – städtisch, pauperisiert und ohne Stimme – führten zur Gleichsetzung von Dissens mit Gewalt. Nicht ohne Grund war Gewalt für Marx die Hebamme aller Revolutionen. Und in der Debatte zur Theorie des gerechten Krieges über den Einsatz von Gewalt haben sich westliche Philosophen von Augustinus und Thomas von Aquin bis zu Grotius und Pufendorf bemüht, das spirituelle christliche Gewalt- und insbesondere Tötungsverbot mit der Realpolitik von Krieg, Imperialismus und, im heutigen Sprachgebrauch, „Regimewechsel“ zu vereinbaren.
Es ist kein Zufall, dass viele der frühen Theoretiker des gerechten Krieges sich gleichzeitig mit der ursprünglichen Gesellschaft beschäftigten. Die Tradition des Naturrechts lässt sich als der theoretische „Klebstoff“ betrachten, der die Überschneidungen dieser beiden Diskurse zusammenhält. Die Integration von Gesetz und Vernunft in die christliche Moral führte zu Diskussionen über den angemessenen Einsatz von Gewalt, über seine Verhältnismäßigkeit, über die Gerechtigkeit der Konfliktursache, die rechtmäßige Absicht der Akteure und die Bedeutung der Selbstverteidigung. Für Thomas von Aquin und die Scholastiker war das Naturrecht im Christentum begründet, gleichzeitig aber dank seiner positivistischen Implementierung auch unabhängig von ihm. Später zeigten Pufendorf, Grotius und Locke, dass die Gesellschaft im Grenzbereich zwischen der naturrechtlichen menschlichen Gesellschaft und dem Staat existiert, der auf Vertrag und Zustimmung der Regierten basiert. Der heilige Gral der liberalen Philosophie – die Gleichzeitigkeit von Freiheit und Gleichheit – lässt sich nicht durch logische oder Verfahrensrationalität erreichen, die den Einsatz von Gewalt erlaubt, um diese gesellschaftlichen und individuellen Ziele zu erreichen. Von dieser Tradition, die die praktische und moralische Verpflichtung auf Gewaltlosigkeit mit der Würdigung des öffentlichen Raumes der Zivilgesellschaft verbindet, ist der ostmitteleuropäische Dissens geprägt.
In der Forschung hat vor allem Jonathan Schell das Werk des ostmitteleuropäischen Dissens – als Œuvre – in die breitere Literatur zu Gewaltlosigkeit und zivilem Ungehorsam eingeordnet. Er hat die Theorie und Praxis der Dissidenten der 1970er und 1980er Jahre an den globalen Abschied vom „Kriegssystem“ gebunden und ihr Handeln in einer umfassenderen „Logik des Friedens“ verortet, die seiner Meinung nach das 21. Jahrhundert zunehmend prägen wird. Sein Argument ist prinzipiell als auch praktisch. Die Revolutionen und die durch die Kette der Ereignisse von 1989–1991 erreichten Veränderungen waren erfolgreicher als jeder Krieg. Schell weist darauf hin, dass sich Mitte des 20. Jahrhunderts die Einstellungen zu Gewalt und zum Dissens global grundlegend veränderten – Einstellungen, die weit über die besonderen Erfordernisse von Sozialismus und Stabilität im Ostblock hinausgingen. Am Ende des Zweiten Weltkriegs schuf man immer tragfähigere internationale Rechtsvorschriften, die den zulässigen Einsatz von Gewalt zwischen Staaten einschränkten. Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen verbietet Krieg nach internationalem Recht, abgesehen von der Selbstverteidigung.
Dazu kommt, dass Gewalt – als Begleiterscheinung der Entkolonialisierung, als Auseinandersetzung (in Stellvertreterkriegen) zwischen den Supermächten, als gesellschaftlicher Widerstand oder Bürgerkrieg – zunehmend als menschliches Scheitern betrachtet wird. Die Lektionen von Somme und Verdun, Auschwitz und Bergen-Belsen, Vorkuta und Kolyma, Hiroshima und Nagasaki verbinden sich zu einer kohärenten Verpflichtung auf Gewaltlosigkeit. Aus Krieg wurde Revolution, die wiederum ihre Kinder fraß oder zu modernen Massenverbrechen wie Völkermord führte. Gewalt zeugte nicht nur Gewalt, sondern wurde zum utilitaristischen Mittel für utopische Teleologien, die zu beträchtlichen gesellschaftlichen und moralischen Verwerfungen führte. Aber während diese historischen Erfahrungen totaler gesellschaftlicher Gewalt die Umrisse der Nachkriegsordnung prägten, stellte gleichzeitig etwa Gandhis indische Satyagraha-Kampagne Alternativen zur behaupteten Gleichsetzung von substantieller politischer Veränderung und Gewalt vor. Der nukleare Rüstungswettlauf der Nachkriegszeit und die damit verbundene Abschreckungstheorie (mit der garantierten „vollständigen gegenseitigen Vernichtung“) war ein zusätzlicher starker Anreiz, diese Gleichsetzung zu verändern, denn noch nie war der Einsatz so hoch.
Für die Ostmittel- und Osteuropäer verbot sich die Option eines gewaltsamen Aufstands taktisch und strategisch von selbst – angesichts des nuklearen Rüstungswettlaufs, der Führungsrolle der Partei und vor allem der geopolitischen Realität nach 1968, für welche die Brežnev-Doktrin stand. Adam Michnik erklärte denn auch: "Der Glaube, durch Revolution die Diktatur der Partei zu beseitigen, und die bewusste Organisation von Aktionen zu diesem Ziel sind so unrealistisch wie gefährlich." In Ungarn sprach György Konrád angesichts der Tatsache, dass die Grenzen unübersehbar von der UdSSR und dem „militärischen Gleichgewicht“ gezogen wurden, von der Unmöglichkeit, das System „durch dynamische, unkontrollierte Massenbewegungen“ zu verändern. Und in der Tschechoslowakei diskutierte der Dissident und Dramatiker Václav Havel über die dramatische Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten durch das „Zentrum der Supermacht“ und empfahl lokale, begrenzte Aktionen, um „bescheidene, konkrete Ziele“ zu erreichen. Dieser gemeinsame Ansatz – von Havel und Konrád als „Antipolitik“ bezeichnet – bestand darin, einen gesellschaftlichen Raum für Selbsthilfe, Selbstbildung, künstlerischen und literarischen Ausdruck sowie Rechtsschutz jenseits des Parteienstaates zu schaffen. Michnik bezeichnete diesen Ansatz als „neuen Evolutionismus“, Havel als „Leben in der Wahrheit“ und János Kis als „radikalen Reformismus“. Als Lehre aus dem Prager Frühling wurden Reformen „von oben“ als unmöglich abgelehnt. Gewalt galt nicht nur als politisch, sondern auch als moralisch inakzeptabel: Die Theoretiker des Dissens wollten nicht dem Feind gleichen, den sie verachteten. Im Anschluss an Arendt und Camus war für Michnik die Anwendung von und die Drohung mit Gewalt spezifisch für die Genese des Totalitarismus.
John Keane betrachtet Gewaltlosigkeit des ostmitteleuropäischen Dissens unter einem anderen Aspekt – nicht als Alternative zum Kriegssystem, sondern wegen ihrer kritischen „Wahlverwandtschaft“ zu Zivilgesellschaft und Demokratie. Zivilgesellschaftliche Politik mit ihrer Abneigung gegen Monismus, instrumentelle Vernunft und Uniformität genauso wie gegen bürokratischen Autoritarismus und den kommunistischen Parteienstaat beruhe auf lokalem Engagement, Diversität, Innovation, Widerspruch und Kontroverse. Zivilgesellschaften würden durch Gewaltlosigkeit genährt und seien von ihr abhängig, weil sie erkannt hätten, dass apokalyptische Revolutionsvorstellungen einen Gewaltzyklus in Gang setzten. Keane zitiert Michniks bekannten Aphorismus: „Wenn wir die alte Bastille mit Gewalt stürmen, dann, so fürchten wir, könnten wir dadurch unbeabsichtigt eine neue bauen.“ Zudem, so Keane, erfordere Demokratisierung die Diffusion von Macht, gewaltlose Organisation und Selbstschutz, Bürgerbeteiligung, soziales Vertrauen, Akzeptieren einer loyalen Opposition – politische Tugenden also, die in der Zivilgesellschaft kultiviert werden und von der Verwirklichung der Gewaltlosigkeit abhängig sind.
Der Erfolg der Gewaltlosigkeit als moralische Strategie und effektiver Operationsplan in Ostmittel- und Osteuropa führt uns abschließend zur Revolutionsforschung. Die Folgen der Revolutionen von 1989 für dieses Forschungsfeld laufen in der Tat auf eine Revolution – einen Paradigmenwechsel – in der wissenschaftlichen Revolutionstheorie hinaus. Vor diesen überwiegend „samtenen“ Revolutionen ging man von einer positiven Korrelation zwischen dem Niveau gesellschaftlicher und politischer Transformation und dem Niveau an Gewalt aus, was auch erklärt, warum die Wissenschaft anfangs zögerte, diese Veränderungen überhaupt als revolutionäre zu akzeptieren.
DISSENS UND REVOLUTION
Die Forschung zur Revolution hat sich mehr als die zu Dissens und Gewaltlosigkeit darum bemüht, die Ereignisse von 1989–1991 zu bearbeiten. Aber die komparativ arbeitenden Historiker, Politikwissenschaftler und Soziologen, die sich mit Revolutionen befassen, haben trotz aller Lippenbekenntnisse, die sie der Regionalforschung schenken, den Dissens kaum angemessen berücksichtigt, so dass das Narrativ vom Fall des autoritären Kommunismus weitgehend ohne Detailkenntnisse über die Geschichte, Soziologie und die in dieser Region mit Dissens assoziierten Ideen angelegt wird. Entsprechend fragen sie nicht, wie, sondern warum 1989 möglich wurde und verstricken sich in die selbstquälerische Debatte, ob das Ereignis vorhersehbar gewesen sei oder nicht.
Jack Goldstone hat skizziert, wie aus 1989 eine „vierte Generation“ der Revolutionstheorien entstanden ist, die das Handeln (agency) oder das „strukturierte Handeln“ (structured agency) von Eliten und Gesellschaften, Kontingenz und die Komplexität vielfältiger Prozesse betont. Die Revolutionsforschung hat bereits zahlreiche Veränderungen durchlaufen. Die Forschung des 19. Jahrhunderts konzentrierte sich in weiten Teilen auf die Frage nach der Kausalität: Welche Faktoren oder welches Faktorenbündel führen zu revolutionären Situationen oder Revolutionen in Staaten und Gesellschaften? Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde diese „erste Generation“ der Debatte durch breitere Diskussionen über die Beziehungen zwischen Modernisierung und Revolution ersetzt. Unmittelbar nach 1989–1991 zögerten viele, die Ereignisse als revolutionär zu bezeichnen, weil die Kämpfe nicht jenen in Frankreich nach 1789 oder in Russland 1917 ähnelten und es zu keiner gewaltsamen Machtübertragung gekommen war. Für Goldstone machte es die Erfahrung der Revolutionen am Ende des 20. Jahrhunderts (in Europa, aber auch beim Übergang zur Demokratie in Schwarzafrika, bei den fundamentalistisch-islamischen Bewegungen und den Guerillakriegen in Lateinamerika) erforderlich, eine „vierte Generation“ der Revolutionstheorie zu entwickeln, die Ideologie, Kultur, Führung und Kontingenz stärker beachten müsse. Revolutionstheorie müsse zudem auch andere Forschungen berücksichtigen, zum Beispiel zu sozialen Bewegungen und kollektiven Aktionen, weil es viele wichtige Variablen wie Massenmobilisierung, ideologische Konflikte und Konfrontationen mit Autoritäten gebe, die sich offensichtlich überlappten. Und John Foran schließlich hält es für nötig, auch in der Revolutionstheorie die kulturellen Ursprünge von Revolutionen und die Rolle kultureller Kräfte zu berücksichtigen.
Viele Autoren gehen heute davon aus, dass die Ereignisse von 1989 vor allem wegen ihrer Gewaltlosigkeit und ihres zivilgesellschaftlichen Fokus eine Revision der revolutionstheoretischen Kategorien und Definitionen erzwungen hätten. Goldstone empfiehlt, Skocpols klassische Definition der Revolution als "schnelle, grundlegende Transformation der Staats- und Klassenstrukturen einer Gesellschaft […] begleitet und teilweise durchgeführt durch klassengestützte Revolten von unten" durch folgende zu ersetzen:
"[…] die Bemühung, die politischen Institutionen und die Rechtfertigung der politischen Autorität in einer Gesellschaft zu transformieren, begleitet von formaler oder informeller Massenmobilisierung und nichtinstitutionelle Aktionen, die die existierenden Autoritäten unterminieren."
Mark Katz definiert Revolution erstens durch den Sturz eines alten Regimes mit nichtlegalen Mitteln und zweitens durch dessen Ablösung durch ein neues Regime, das mindestens eine neue politische und potentiell auch eine neue sozioökonomische Ordnung etablieren will. Beide Anforderungen waren 1989 gegeben. Aber eine bessere Kenntnis des Dissens führt zu einer deutlichen Lehre: Das revolutionäre Gewaltethos ist erschöpft. Damit gerät ein Paradigma der Revolution grundlegend ins Wanken, nach dem Gewalt, bewaffneter Konflikt und eine ideologisch motivierte Führung notwendig für den Erfolg seien. Schließlich gehen viele Revolutionstheoretiker von Weber über Skocpol bis zu den Strukturalisten der vierten Generation auf Marx zurück, auch wenn sie mit seinen Grundthesen nicht übereinstimmen. Sie betonen Klassen- oder Gruppenkonflikte, die Rolle der Modernisierung, der Industrialisierung oder generell die materiellen Bedingungen, diskutieren die Schnittstelle und das Zusammenspiel von politischen und sozialen Strukturen, in die die Akteure eingebettet und beeinflusst, aber nie völlig kontrolliert werden. Zudem behaupten sie den Primat revolutionärer Gewalt, eine Ideologie der Emanzipation und die utopische These vom Neubeginn der Geschichte und der menschlichen Natur.
Auch Hannah Arendt geht von Marx aus, bleibt aber wegen der Prägnanz ihrer Argumente über die Amerikanische Revolution die wohl wichtigste Analytikerin für die Untersuchung der Rolle des Dissens bei den Revolutionen in Ostmittel- und Osteuropa. Für Arendt war die Amerikanische Revolution eine Nicht-Revolution, für die die üblichen Regeln nicht gelten, denn dort gab es bereits eine Ideologie der Gleichheit, begleitet von der Annahme eines materiellen Überflusses anstelle materieller Knappheit. Für beide Bedingungen finden sich Analogien in Ostmittel- und Osteuropa. Erstens war die Verpflichtung auf Gleichheit kulturell eingebettet, aber die Kluft zwischen Ideologie und Realität eklatant. Zweitens war durch die Existenz und die Wahrnehmung der westeuropäischen Konsumgesellschaften das Potential für Überfluss real und greifbar – wenn in Berlin und Wien, warum dann nicht in Leipzig und Prag?
Und schließlich predigte die amerikanische Revolution im Gefolge Lockes Toleranz und fraß, worauf Arendt hinwies, die eigenen Kinder eben nicht. Die Amerikaner von 1776 waren keine Revolutionäre aus Absicht, sondern aus Versehen: Sie wollten Freiheit und bekamen die Unabhängigkeit. Laut Arendt kann man also über die amerikanische Revolution unmöglich in binären Kategorien wie revolutionär oder restaurativ, radikal oder konservativ sprechen. War die Französische Revolution die Ur-Revolution, dann war die amerikanische die Anti-Revolution. Dennoch war das Ziel in beiden Fällen nicht Revolution an sich, sondern die Gründung einer politischen und gesellschaftlichen Basis für das Gedeihen der Freiheit. Revolution begann also in „Freiheitsinseln“ der Selbstorganisation der Gesellschaft oder der Parallel-Polis, nicht mit dem revolutionären Wunsch nach Regimewechsel. Zudem war diese Freiheit zwar keine ökonomische, aber eine recht konkrete: die Freiheit, dem eigenen Gewissen oder der eigenen Überzeugung gemäß sprechen, schreiben, lesen, reisen und sich in unabhängigen Gruppen versammeln zu können. Der Fokus beider Gruppen von Revolutionären lag also auf den Institutionen – zuerst in der Zivilgesellschaft (man denke an die vielen fliegenden Universitäten, unabhängigen und Samizdat-Verlage, kulturellen Organisationen) und später durch die Neubildung und Neuverfassung des Staates. Dieser Fokus führte zur Fixierung auf institutionelle Fragen und Verfahren wie Wahlen und Volksentscheide, Verfassung, Organisation von Parlamenten und die Einzelheiten der Gewaltenteilung und des Gleichgewichts der Macht, zu dem auch das Primat des unabhängigen Rechts über die Politik und die Durchsetzung des Primats der Politik gegenüber der Wirtschaft gehörte.
Aber die Revolutionen in Ostmittel- und Osteuropa waren noch postmaterialistischer als die amerikanische, das heißt, sie lagen jenseits des „erschreckende(n) Schauspiel(s) menschlicher Not, (wohin) die anklagende Stimme des Elends nicht drang“. Anders als in China, Mexiko, Frankreich oder Russland waren die Revolutionäre in Ostmitteleuropa nicht mit überwältigendem menschlichem Leid und Erniedrigung konfrontiert. Ironisch könnte man sagen: sie hatten die Freiheit, sich auf die Freiheit zu konzentrieren. Bruce Ackermann und andere haben sie gelegentlich auch als „liberale“ Revolutionen bezeichnet, nicht wegen restaurativer Impulse oder mangelnder konkreter oder auch nur radikaler Reformziele, sondern im etymologischen Sinne: auf die Freiheit bezogen.
Abgesehen von der wissenschaftlichen Debatte um eine Neudefinition des Revolutionsbegriffs, die die Revolutionen in Ostmitteleuropa angestoßen haben, bleibt die Frage, wie sie in diese lange Tradition passen. Festzuhalten ist erstens, dass der Staatssozialismus sich gründlich „erschöpft“ hatte und konnte seine vielen Widersprüche im Marxschen Sinne nicht mehr kontrollieren. Die Politik war also reif für eine Transformation. Außerdem waren diese Widersprüche nicht nur wirtschaftlicher, sondern (nach Skocpol) politischer, ideologischer und militärischer Art, vor allem, wenn man berücksichtigt, dass die Revolutionen in der Region ihren Höhepunkt während der Krise und des Zusammenbruchs der Sowjetunion erreichten. Zweitens muss man die Entrechtung und Passivität der Arbeiter untersuchen, in deren Namen der Parteienstaat aufgebaut worden war, denen er aber in Wahrheit nicht diente. Drittens waren Revolutionen nur dann möglich und „fertig“, wenn Koalitionen entstanden und verhandelten, zu denen auch die oppositionellen Eliten und Dissidentenbewegungen gehörten. Es handelte sich um lokale, spezifische, historisch kontingente, veränderliche und in den verschiedenen Nationalkulturen verwurzelte Koalitionen. Die handelnden Personen berücksichtigten in ihren Strategien die früheren Versuche, etwas zu verändern, die allesamt gescheitert waren. Ihnen allen fehlte ein revolutionäres oder Klassenbewusstsein im weiteren Sinne, ob sie nun aus Arbeitern, Intellektuellen oder mobilisierten Bürgern bestanden, die ihnen eine Übergangslegitimität verliehen, oder ob „gemäßigte“ Angehörige des herrschenden Regimes und pragmatische Oppositionsführer bereit waren, (zumindest übergangsweise) einen dicken Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen. Die Angehörigen der Führung allerdings wurden ideologisch entrechtet und politisch verfolgt. Da die gesellschaftliche Unterdrückung in gewissem Sinne egalitär war, gab es eine Basis für die Solidarität derjenigen, die jenseits des Parteienstaats standen und die Privilegien der Nomenklatura nicht genossen. Aber dennoch gab es kein revolutionäres Bewusstsein: die Dissidenten taten, was sie taten, weil sie das Leben erträglicher machen und nicht, weil sie ausdrücklich das Regime überwinden wollten.
Für Jeff Goodwin haben die antikommunistischen Revolutionen große Ähnlichkeit mit den Revolutionen im 20. Jahrhundert in Ländern der sogenannten Dritten Welt. Jeweils fanden sie in relativ geschlossenen, autonomen Staaten mit schlechter Wirtschaftsleistung und exzessiver politischer, ökonomischer, ideologischer und militärischer Abhängigkeit von einer fremden Macht statt. Die einzige Garantie ihrer Autonomie war die Übernahme des sowjetischen Modells und die Anerkennung ihrer begrenzten Souveränität – nach der Logik der Brežnev-Doktrin. In dem zur „Normalisierung“ nach 1968 gehörenden Sozialvertrag gaben die Regimes ihre ideologischen oder politischen Legitimitätsansprüche auf. Die einzige Basis für eine Beziehung mit der eigenen Bevölkerung blieb die Fähigkeit, Güter zur Verfügung zu stellen – und das in Volkswirtschaften, die strukturelle Defizite hatten, die Konsumbedürfnisse zu befriedigen.
Dieser Ansatz wirft einige Fragen auf. Es bedarf jedoch einer genaueren Beschäftigung mit dem „real existierenden Dissens“. Goodwin weist zurecht auf die Ähnlichkeiten hin, etwa auf den klassenübergreifenden Charakter der Revolution und den verbreiteten Zorn auf die Staatsbehörden. Aber gegen Goodwins These spricht die Tatsache, dass die führenden Dissidenten bewusst nicht radikal waren und keine quasi-utopischen „imitativen“ und „reaktiven“ Ideologien vertraten. Im Gegenteil, sie waren äußerst vorsichtig, setzten sich enge Grenzen und waren zudem entschieden anti-utopisch, anti-teleologisch und anti-ideologisch.
Jack Goldstone versteht den Zusammenbruch der UdSSR zudem als eine große Revolution, verortet sie aber in der Tradition der Revolutionen in modernen Diktaturen, bei denen neopatrimoniale Regimes durch eine Kombination von Druck aus dem Ausland, Elitekonflikten und Volksaufstand gestürzt werden. Die Sowjetwirtschaft stagnierte, das Regime scheiterte ideologisch, die Eliten kündigten entweder stillschweigend ihre Unterstützung auf oder agitierten öffentlich für Reformen, und öffentlicher Protest regte sich in Demonstrationen lange vor dem entscheidenden im August 1991 gegen die Putschisten. Aber auch hier berücksichtigt Goldstone die Rolle des Dissens bei der ideologischen Delegitimierung des Regimes nicht – als angesehene Wissenschaftler wie Andrej Sacharov und Jurij Orlov offen dem Regime trotzten und für den Helsinki-Prozess eintraten, war der Kaiser nackt – und das lange vor Gorbačev. Zudem bedeutete die nur partiell gelungene Verbindung der Dissidenten mit der entrechteten Bevölkerung – die auch in der Transformationszeit nicht gelang –, dass aus den aufkeimenden Zivilgesellschaften keine funktionale Opposition werden konnte, die auf nationaler Ebene den Rechtsstaat und Grundrechte wie Rede- und Versammlungsfreiheit hätte gewährleisten können.
Goldstone nimmt die Revolutionen von 1989–1991 zum Anlass, seine These von der Vorhersagbarkeit von Revolutionen zu stärken. Deshalb sucht er nach Faktoren, die man hätte vorhersehen sollen, etwa das Scheitern der Ideologie und der wirtschaftliche Niedergang, der sich in der Entfremdung der Eliten niederschlug sowie die langfristige Unhaltbarkeit von Glasnost’. Aber Goldstone berücksichtigt nicht, wie wichtig die Dissidenten waren, um das ideologische Scheitern bewusst zu machen, und welche zentrale Rolle sie für die gesellschaftliche Mobilisierung spielten. Das liegt zum Teil daran, dass er die revolutionären Ereignisse in der UdSSR mit der gesamten Periode 1989–91 gleichsetzt. Die Ereignisse in der UdSSR von Černobyl’ 1986 bis zum gescheiterten Putsch vom August 1991 lassen sich aber nicht ohne Bezug auf diese Bewegungen verstehen, insbesondere wegen der transnationalen Verbindungen zwischen den Dissidenten und wegen des frühen „Initiationseffekts“ der Polen beim Regimewechsel.
Wer die Revolutionen in Ostmittel- und Osteuropa untersucht, sollte den Dissens berücksichtigen. Dadurch wird die Wissenschaft gezwungen, über die konventionellen Erklärungen hinauszugehen, die den Sturz des autoritären Kommunismus auf das wirtschaftliche Scheitern oder den „Gorbačev-Faktor“ zurückführen. Die Berücksichtigung des Dissens trägt dazu bei, die Revolutionen in ihrer Langlebigkeit, Vielfalt und Komplexität zu historisieren – als der Abschluss eines langen nichtrevolutionären Widerstands. Gleichzeitig lassen sich so die neuen Mikro-Geschichten, die sich dem Zugang einer neuen Generation postkommunistischer Wissenschaftler zu den Archiven verdanken, in den größeren Kontext einordnen und viele Deutungen und vermeintlichen Kausalitätsketten hinterfragen. Viele dieser Revolutionsforscher der „vierten Generation“ haben die ostmittel- und osteuropäische Erfahrung eingebracht. Die Ereignisse von 1989–1991 haben wichtige Beobachtungen ermöglicht, etwa die relative Gewaltlosigkeit des revolutionären Übergangs, die Kombination aus Reformversuchen von oben und Dissens von unten, den „Wellencharakter“ von Revolutionen, der durch transnationale Unzufriedenheit bedingt war. Aber auch die Rolle der Ideologie, der Unterstützung durch wichtige externe Akteure wie etwa Gorbačev oder internationale Vereinbarungen wie die KSZE sowie die Beziehung zwischen formalem Dissens und informeller Mobilisierung oder die historische Bedeutung von „Rebellionskulturen“ gerieten in den Blick.
Aber wie so oft bei ausgreifenden komparativen Analysen hat die Berücksichtung der ostmittel- und osteuropäischen Erfahrung nicht zwangsläufig dazu geführt, die historischen Spezifika zu beachten. Die Erforschung der spezifischen Fälle könnte spannende Ergebnisse bringen, etwa die Erkenntnis, dass die Gewaltlosigkeit der Revolutionen in der Region (dank der Verpflichtung auf Selbstbeschränkung und neuen Evolutionismus) strategisch und zielgerichtet war, die analytische Einsicht, dass die strikte Trennung von Reform und Revolution falsch ist, insbesondere bei Revolutionen, die nicht per se als Revolutionen begannen, und dass populärer Dissens, Unruhe und Mobilisierung zwar im „Augenblick“ der Revolution von Bedeutung sind, aber im Kontext der longue durée des Dissens betrachtet werden müssen (Tabelle 1). Die ostmitteleuropäische Erfahrung trägt viel zum Verständnis der dialektischen Beziehung der „Gipfel“ und „Täler“ des Dissens und des gesellschaftlichen und regionalen „Lernens“ in der Zeit zwischen den „Gipfeln“ bei. In dieser Hinsicht kann man Revolutionen nicht von der „normalen“ Geschichte trennen, sondern muss sie darin einbetten, um all die „kleinen Aktionen“, die die Gesellschaft auf subtile, aber wichtige Weise zur Reform und später über den Wendepunkt zur Revolution hinaus führten, nicht zu übersehen.
Auch die nicht geringere Bedeutung der Anti-Ideologie darf nicht übersehen werden, das heißt die tiefe Ablehnung von Bemühungen zur totalen Neugestaltung der Gesellschaft und utopischer, teleologischer Erklärungen vom Ende der Geschichte. Und so wichtig die Unterstützung durch externe Akteure auch sein mag, so wichtig ist es, ihre Rolle wirklich zu verstehen. Goldstone irrt, wenn er behauptet, Gorbačev habe dem Dissens Raum gegeben, „um die Entschlossenheit der kommunistischen Regimes zu testen“, denn ihm ging es nicht um die Demontage, sondern um die Reform des Systems. Und selbst als er die Brežnev-Doktrin durch die „Sinatra-Doktrin“ („I do it my way“) ersetzte, spricht vieles dafür, dass er immer noch von der Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit ausging, das Sowjetsystem zu reformieren. Entsprechend sind auch transnationale Entwicklungen nicht nur auf der Ebene der „hohen Politik“ (wie etwa der KSZE-Prozess), sondern auch auf informeller und zwischenmenschlicher Ebene wichtig. Helsinki eröffnete dem Dissens neue Möglichkeiten, weil die Dissidenten ihre Staaten nun auf die Einhaltung dieser Vereinbarung verpflichten konnten. Das ermöglichte ihnen die Entwicklung eines Netzwerks mit Emigranten in der Diaspora und den Vertrieb von Publikationen aus dem Samizdat und Tamizdat. Auch die Beziehung zwischen formalem Dissens und informeller Mobilisierung sollte weiter untersucht werden: Waren die „spontanen“ Proteste wirklich so spontan? Welche Kombination von Faktoren bei der relativ plötzlichen und euphorischen Mobilisierung in Deutschland, der Tschechoslowakei und Rumänien auch eine Rolle gespielt haben mögen, fest steht, dass mehr als persönliche Freundschaften oder Arbeits- und Nachbarschaftsnetzwerke daran beteiligt waren. Und doch resultierten diese eindrucksvollen Erhebungen der „Volksmacht“ nicht aus den traditionellen Paradigmen revolutionärer Führung (nach dem leninistischen Avantgarde-Modell). Wahrscheinlich bestätigen sich die Theorien der „vierten Generation“, die Handlungsfähigkeit und Kontingenz stärker berücksichtigen – formale Organisationen unterschieden sich in Größe und Diversität beträchtlich, halboffizielle Institutionen (wie die katholische Kirche in Polen und die evangelische Kirche in der DDR) und Akteure aus der „Grauzone“ waren im Herbst 1989 vielleicht ebenso wichtig wie die Dissidenten. Auch die „karnevalesken“ Elemente von 1989–91 verdienen eine revolutionstheoretische Untersuchung.
Insgesamt könnte eine Verbindung der vergleichenden Revolutionstheorie mit den neu entstehenden Mikrogeschichten des Dissens genauere Ergebnisse bringen. Goldstone zum Beispiel behauptet:
"1956 in Ungarn und 1968 in der Tschechoslowakei wankten die Regimes so sehr, dass die Reformer radikale Veränderungen der sozialistischen Herrschaft fordern konnten. Dennoch wurden die weitverbreiteten öffentlichen Aufstände dank der massiven externen Repression der Sowjetunion niedergeschlagen."
Die Narrative der Historiker über 1956 und 1968, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten Zugang zu den Archiven hatten, sind weit weniger schablonenhaft, als dieses Zitat nahelegt. Granville und Kierens haben nachgewiesen, dass das Denken, die Motive und die Aktionen der Reformkräfte aus der Elite keineswegs monolithisch war. Imre Nagy und Alexander Dubček engagierten sich weit mehr für die Reform des Kommunismus als für seine radikale Veränderung. Die sowjetische Führung schwankte stärker als bislang angenommen, und der Charakter der öffentlichen Aufstände war ebenfalls sehr unterschiedlich und reichte von Konterrevolution (im sowjetischen Sinne) bis zur radikalen Demokratie (Arbeiterräte). Zudem war die Kontrolle, welche die staatsozialistischen Regierungen qua Parteiapparat und diverse Mittlerorganisationen über die Gesellschaft ausübte, nicht so stark, wie Revolutionstheoretiker gelegentlich glauben. Das macht die „Erosion“ des kommunistischen Staats weniger beeindruckend als der vermutete rapide Kollaps.
Das Einbeziehen der Geschichten und alternativen Kulturen des Dissens in Ostmittel- und Osteuropa widerlegt die Revolutionstheorie der „vierten Generation“ keineswegs, sondern bereichert ihre Schlussfolgerungen. Aber es fehlt noch das große Werk historischer Soziologen oder Politikwissenschaftler mit fundierten Kenntnissen der verschiedenen Revolutionstheorien, das am Beispiel Ostmittel- und Osteuropas meine Behauptungen bestätigen oder widerlegen könnte. Der bisherige Überblick und die Tabelle sind nur flüchtige Skizzen für die weitere Forschung. Die Einbeziehung der Geschichte des Dissens könnte ein Anstoß sein, global über die Rolle nichtstaatlicher Akteure, ihre Form und Methoden der transnationalen Kommunikation und Einflussnahme nachzudenken. Um mehr über diese Kommunikations- und Einflusswege, ihre jeweilige Bedeutung, Richtung und Kausalität zu erfahren, muss man den dokumentierten „umgekehrten Domino“- oder „Mitläufer-Effekt“ der Revolutionen von 1989-1991 historisch untersuchen. Jeff Goodwin behauptete 2001, revolutionäre Bewegungen und Revolutionen seien „in unserer Zeit unwahrscheinlicher als zur Zeit des Kalten Krieges“. Aber wenn man die zentrale Erfahrung von 1989–1991 für die Entwicklung eines neuen Paradigmas gewaltloser Revolutionen ernst nimmt, könnten zukünftige Revolutionäre einem nichtmarxistischen Weg folgen. Außerdem widerlegen die Revolutionen in Serbien 2000, in Georgien 2003, in der Ukraine 2004 und in Kirgistan 2005 Goodwins Erwartungen und zeigen, dass die revolutionäre Geschichte noch nicht vorbei ist. Gewiss haben liberale Dissidenten im Libanon, in Ägypten und im Iran die Erfahrungen in Ostmittel- und Osteuropa so genau beobachtet wie die autoritären Regimes, in denen sie leben. Und diese beschränken die Rede- und Versammlungsfreiheit, wo immer möglich, um die Entwicklung alternativer Dissens- und Oppositionskulturen mit Gewalt zu verhindern.
ZUSAMMENFASSUNG
Der Dissens in Ostmitteleuropa und Osteuropa ist in drei Felder einzubetten: in die politische Theorie des Dissens und der Toleranz (sowie der Repression als ihres Gegenteils) in die vergleichende historische und politische Theorie der Gewaltlosigkeit sowie in die Theorie der Revolution. Die politische Theorie hat dabei den längsten Weg zurückzulegen, muss sie doch in ihrem Kanon das Denken und Handeln der Dissidenten als Œuvre erst noch ernst nehmen. Ein sinnvoller analytischer und historischer Ausgangspunkt könnte es sein, dieses Œuvre in den Kontext der breiteren Tradition des Dissens in der politischen Theorie zu stellen. Durch die Verbindung des Dissens mit den beiden anderen Forschungsfeldern wird das Merkmal der Revolutionen in Ostmittel- und Osteuropa deutlich: Sie waren Revolutionen in Theorie und Praxis, weil sie sich prinzipiell und praktisch auf Gewaltlosigkeit verpflichtet hatten. So gesehen, ist die Verbindung zweier scheinbar unmöglicher historischer und politischer Wege das wichtigste Vermächtnis.
Mit Arendt lässt sich sagen, dass die Revolutionen von 1989–1991, einst historisch neu und analytisch herausfordernd, unzweifelhaft der Vergangenheit angehören. Aber ihre Lehren und ihr Vermächtnis für die Wissenschaft und die politische Praxis sind nicht nur Teil unserer Gegenwart, sondern werden auch in Zukunft oft berücksichtigt werden. George Orwell hat mit dem charakteristischen Pessimismus, der 1984 zugrunde liegt, einmal besorgt geäußert, zwar sei noch jede Tyrannei der Vergangenheit gestürzt worden, weil das Streben nach Freiheit zum Wesen des Menschen gehöre, aber das social engineering, das dem totalitären Projekt inhärent sei, stelle diese Annahme in Frage. Zu den wertvollsten Vermächtnissen des Dissens zählt der Beweis, dass das Experiment der Schaffung des homo sovieticus spektakulär und in jeder Beziehung gescheitert ist.
Aus dem Englischen von Irmgard Hölscher, Frankfurt/Main
Erschienen in: Osteuropa, 11/2010, S. 5-27
Barbara J. Falk (1962), PhD., Professorin für Politikwissenschaft, Canadian Forces College, Toronto
Volltext als Datei (PDF, 317 kB)