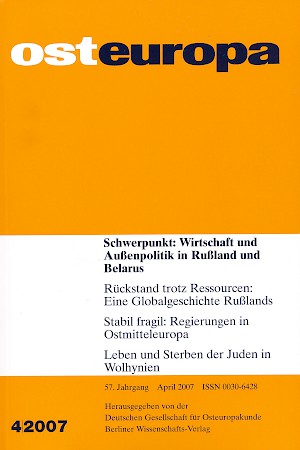Neues aus den Partisanenwäldern
Artur Klinaŭ über subversive Kultur und die Kultur des Subversiven
Volltext als Datei (PDF, 309 kB)
Abstract in English
Abstract
Der weißrussische Künstler und Schriftsteller Artur Klinaŭ sieht ein Jahr nach der Niederschlagung der Proteste gegen die manipulierten Präsidentschaftswahlen in Belarus das Land erneut in einen lethargischen Schlaf versunken. Doch das Überwintern unter widrigen Umständen ist für die Weißrussen nichts Neues. Die Kriege und Verwüstungen, die immer wieder von Ost und West über das Land hinwegwalzten, haben eine Partisanenmentalität entstehen lassen, die das Volk vor dem Verschwinden bewahrt hat. Unter dem Diktator Lukašėnka hält nicht oppositionelle Politik das Land offen für Europa. Diese Rolle übernehmen moderne, subversive Kunst und Literatur, die etwa in der von Klinaŭ herausgegebenen Zeitschrift pARTisan zu ihrem Recht kommen.
(Osteuropa 4/2007, S. 93–100)
Volltext
KATHARINA NARBUTOVIČ: Die Präsidentschaftswahlen in Belarus und die Proteste gegen deren Manipulierung jähren sich in diesen Tagen. Wie ist im Moment die Stimmung in Minsk? KLINAŬ: Still ist es geworden. Das Land ist wieder in einen lethargischen Schlaf gesunken. Doch ganz unabhängig davon: Die Welle des Patriotismus und die Jugendrevolte vor einem Jahr – denn es war ja eine Revolte und keine Revolution –, dies kann keiner mehr dem Land nehmen. Es wird noch lange von dieser Erfahrung der Revolte zehren, und die Ereignisse werden ohne jeden Zweifel Einfluß haben auf die Mentalität der Menschen, die Gesellschaft, die Kunst. Besondere Aktionen zum Jahrestag der Präsidentschaftswahl und zum Unabhängigkeitstag am 25. März wird es aber eher nicht geben. Wie immer werden die Menschen sich versammeln, sie werden demonstrieren und mit dem Knüppel auseinandergejagt werden oder auch nicht, das hängt ganz davon ab, in welcher Stimmung der oberste Mann bei uns im Lande gerade ist. Aber es wird nichts Umwälzendes passieren. Solange nach außen alles schön funktioniert und die Menschen pünktlich ihr Gehalt und ihre Rente erhalten, wird es keinen Aufstand geben. Ernsthafte Veränderungen sind erst in ein, zwei Jahren zu erwarten, wenn eine Wirtschaftskrise ins Haus steht. NARBUTOVIČ: Welche Rolle spielen dabei der Gasstreit und das verschlechterte Verhältnis zwischen Rußland und Belarus? KLINAŬ: Um die Beziehungen zwischen den beiden Staaten ist es schon seit geraumer Zeit nicht gut bestellt, und sie verschlechtern sich immer weiter. Was für die belarussische Wirtschaft natürlich nicht ungefährlich ist. Rußland war schon immer der wichtigste Handelspartner für Belarus, und wenn dieser Markt wegfallen sollte, dann wird das binnen ein, zwei Jahren Folgen haben. Zudem ist unsere Regierung inkonsequent. Einerseits verhält sie sich Rußland – und auch Europa – gegenüber höchst abweisend, und dann wiederum ersucht sie Rußland um einen Kredit von anderthalb Milliarden Dollar zur Stabilisierung der Wirtschaft. Was natürlich eine ausgesprochen gefährliche Angelegenheit ist. Diese hektische Suche nach einem Kredit zeigt, wie es um die belarussische Wirtschaft bestellt ist. Es ist eine paranoide Reaktion der Machthaber, eine Angstreaktion, weil die Situation sich für sie ungünstig entwickelt. Die hektische Suche nach Geld ist ein Ausdruck der Furcht, denn die ökonomische Stabilität im Lande ist der einzige Grund, warum die Regierung sich noch an der Macht hält. Eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation kann ihr den Boden unter den Füßen wegziehen. NARBUTOVIČ: Mit welchem Szenario ist denn zu rechnen? KLINAŬ: Die Experten gehen davon aus, daß sich das belarussische Wirtschaftssystem noch ein, zwei Jahre halten kann und dann kollabiert. Die Preise sind schon jetzt ziemlich hoch. Eine Eigentumswohnung kostet ab 100 000 Dollar aufwärts, und das bei einem Durchschnittsgehalt von etwa 300 Dollar monatlich. Und auch alles andere ist teuer – Kleidung, Lebensmittel, alles. Klar ist, daß die Preise weiter steigen werden, und zwar ohne Angleichung der Gehälter. Die Menschen werden unzufriedener, und es ist durchaus vorstellbar, daß sie auch revolutionär gestimmt sein werden. NARBUTOVIČ: Vor kurzem ist eine neue Ausgabe Ihrer Zeitschrift pARTisan erschienen, die sich mit dem Thema „Urheber und Platz“ beschäftigt. Hat das mit den Ereignissen vom März 2006 zu tun? KLINAŬ: Ja, es ging uns darum, die Rebellion als kulturelles Phänomen zu betrachten und eben nicht als politisches oder soziales. Wir wollten die Bedeutung der Kultur für die März-Ereignisse unterstreichen und zugleich die Folgen untersuchen, die diese Ereignisse für die Kultur haben werden. Es geht also um die Wechselwirkung zwischen Urheber und „Platz“: um die Rolle, die der Urheber der Ereignisse spielt, und umgekehrt um die Frage, welchen Einfluß „der Platz“ auf den Urheber hat. NARBUTOVIČ: Gibt es denn eine Kernaussage, auf die sich alle Autoren der Ausgabe einigen können? KLINAŬ: Nun, daß die Kultur einer der wichtigsten Urheber „des Platzes“ war – wenn nicht sogar der wichtigste. Denn die Menschen sind auf den Platz gekommen, weil sie dem Ruf der Kultur gefolgt sind – nicht dem Ruf der Politik, der Parteien oder der Medien, sondern dem der Kultur. Ich will natürlich nicht die Rolle der Parteien und der Medien leugnen, aber die Parteien waren auf die Situation nicht vorbereitet und haben eine Chance verspielt, weil sie damit nicht umzugehen wußten. Und man kann auch nicht behaupten, daß die Menschen auf den Platz gekommen seien, weil die unabhängigen Medien sie dazu aufgerufen hätten, denn solche gibt es bei uns nicht. Von den Oppositionszeitungen sind gerade mal zweieinhalb übriggeblieben. Die jungen Leute auf dem Platz waren dort, weil sie mit der unabhängigen weißrussischen Kultur aufgewachsen sind und ihrem Ruf, einem inneren Pflichtgefühl gefolgt sind. Die Kultur vermag mehr als die Parteien und die Medien, weil sie grundlegende ethische Werte vermittelt und schneller reagieren kann in einer Situation, in der die Stimme der unabhängigen Parteien und Medien auf einen sehr kleinen Raum beschränkt ist und kaum Gehör findet. Die Kultur kann einen viel breiteren Kreis von Menschen erreichen – und vor allem die jungen Leute. Die Kultur ist also zu einem realen Akteur der Umgestaltung geworden. NARBUTOVIČ: Warum haben Sie Ihre Zeitschrift pARTisan genannt? KLINAŬ: Das hat mehrere Gründe. Zunächst einen historischen, denn das Partisanentum war in den vergangenen Jahrhunderten in der Tat die Überlebenstaktik des weißrussischen Volks. Ohne sie würde das weißrussische Volk nicht mehr existieren, es wäre schon lange ausgemerzt, assimiliert, oder das Land wäre nichts weiter als ein Gouvernement Rußlands. Weißrußland liegt an der Wasserscheide zweier großer Zivilisationen, der europäischen und der eurasischen, und an dieser tektonischen Bruchstelle gab es immer Kolonisationsversuche, Kriege und Eroberungszüge, die über das Land hinwegwalzten, von Ost nach West, von West nach Ost. Um unter diesen Bedingungen als Volk zu überleben, blieb als einziger Ausweg die Mentalität des Partisanen. Dieser psychologische Typus läßt sich nicht mit zwei, drei Worten beschreiben. Ich würde den Partisanen auch nicht heroisieren und aus ihm einen stereotypen Helden machen, einen Macho-Revolutionär mit Sombrero und Pferd à l’américaine. Der Partisan, das ist ein ganz eigener mentaler Typus. Er muß nicht zwangsläufig ein Gewehr in der Hand halten. Mitunter ist es auch einfach nur Überlebenswille, der ihn dazu bringt, sich zu verstecken, unterzutauchen, in die Sümpfe zu gehen, so lange, bis die Wellen von West nach Ost oder umgekehrt über das Land hinweggerollt und abgeklungen sind. NARBUTOVIČ: Das Partisanentum ist also zum einen ein weißrussischer Charakterzug und zum anderen die Taktik der Zeitschrift pARTisan? KLINAŬ: Genau. Historisch hat es sich so gefügt, daß der Partisan zum mentalen Leib des Weißrussen wurde, in jedem Weißrussen also Züge von einem Partisanen vorhanden sind. Und andererseits ist pARTisan eine Tribüne für die unabhängige weißrussische Kultur, die in den letzten Jahren überhaupt nur dank ihres Partisanentums existiert. Die moderne Kultur überlebt bei uns heute mit Partisanenmethoden – die Musik genauso wie das Theater, die bildende Kunst, der Film oder die Literatur. Meist geht ein Prozeß vonstatten, den die Mehrzahl der Zuschauer oder der Bevölkerung überhaupt nicht wahrnimmt, und plötzlich taucht etwas an der Oberfläche auf, tritt offen zutage und verschwindet wieder. Genau so funktioniert jetzt die Kunst, und eigentlich schon lange Jahre. NARBUTOVIČ: Lassen Sie uns noch ein wenig bei der Figur des Partisanen bleiben, offensichtlich gibt es ja zwei verschiedene Typen von Partisanen, den sowjetischen und den weißrussischen? KLINAŬ: Nun, der sowjetische Partisan ist eine Figur, um die sich zahllose Mythen und Legenden ranken, eine Kultfigur, die zu einem wichtigen Bestandteil der offiziellen sowjetischen Kultur und Ideologie wurde. Der sowjetische Partisan ist ein sowjetischer Patriot, der in die weißrussischen Wälder geht, um die sozialistische Ordnung, die Heimat, die Partei und das Volk zu verteidigen. Ein Kommunist und Patriot, der für die Seinen und für seine Überzeugungen kämpft. Dargestellt wird er oft mit einer Papacha, auf dieser ein rotes Band, mit Reiterhosen, Stiefeln, Filzüberwurf. So sieht der Held zahlreicher Filme, Bücher und Gemälde aus. NARBUTOVIČ: Andrėj Kudzinenka hat in seinem beeindruckenden Film Akupazyja. Misteryi aus dem Jahr 2003 herausgearbeitet, daß die offizielle sowjetische Darstellung nicht ganz der Wirklichkeit entspricht. KLINAŬ: Gewiß, was den Partisanenkampf anbelangt, gibt es viele Stereotype und Mythen. Tatsache ist zunächst einmal, daß fast eine Million Menschen in diesen Kampf involviert waren. Doch Fakt ist auch, daß der Partisanenkampf von Moskau ausging, daß Moskau NKVD-Sondereinheiten geschickt hat, um den Partisanenkrieg zu entfesseln. Als er dann erst einmal im Gange war, hat er sich relativ schnell verselbständigt. Darüber sind sich bis auf einige stalinistische Betonköpfe alle einig. In den Partisaneneinheiten gab es dann noch einmal verschiedene Gruppierungen, und nicht alle Formationen waren prosowjetisch eingestellt. Es gab Partisaneneinheiten, die gegen beide Seiten kämpften, es gab Marodeure, die die Bevölkerung bestahlen. Und dann darf man nicht vergessen, daß die oberen Partisanenränge nach dem Krieg fast die gesamte Nomenklatura der Belarussischen Sowjetrepublik stellten und die Schlüsselpositionen besetzten. Eine ganz andere Partisanengeschichte also als in Litauen und der Ukraine. Und ein weitaus komplexeres und bunteres Bild, als es gemeinhin dargestellt wird. NARBUTOVIČ: Und der weißrussische Partisan im Unterschied zum sowjetischen Partisan? KLINAŬ: Das Bild des weißrussischen Partisanen hat mit der nationalen Wiedergeburt zu tun. Adradžėnne, die weißrussische Wiedergeburt Ende des 19. Jahrhunderts, ist eng mit der Partisanentaktik verbunden, denn es handelte sich nicht um eine Massenbewegung, Adradžėnne ging von einzelnen Leuten aus. Und diese Menschen bildeten kleine Einheiten, die sich der Partisanentaktik bedienten. Anders war es gar nicht möglich, weil Weißrußland zu der Zeit Teil des Russischen Reichs war, das einen enormen Druck ausübte, einschließlich gewaltsamer Russifizierung der Städte und Verfolgung der Intelligenzija. Der kulturelle Code ließ sich nur mit Partisanenmethoden bewahren. Der weißrussische Partisan ist sozusagen eine Metapher für die weißrussische nationale Elite, die für den Erhalt der Nation kämpfte, für ihre Wiedergeburt, und dies völlig uneigennützig, denn der Weg der Kollaboration wäre weitaus einfacher gewesen. Partisanentum ist die Überlebenstaktik des weißrussischen Volks. NARBUTOVIČ: Die erste Ausgabe von pARTisan hat den Untertitel „Zeitschrift, die einen dazu bringt, den zeitgenössischen weißrussischen kulturellen Kontext mit anderen Augen zu sehen“. Was meint „mit anderen Augen“? KLINAŬ: Die Aufgabe, die wir uns mit unserer Zeitschrift gestellt haben, ist, jenes Segment der weißrussischen Kultur zu präsentieren, das für Aktualität steht, für Avantgarde im positiven Wortsinn, für Experimente, für ein Nachdenken und eine geistige Auseinandersetzung auf der Höhe der Zeit. Klassische und traditionelle Sachen interessieren uns wenig, das ist nicht unsere Aufgabe und entspricht auch nicht unserem Naturell. Die Zeitschrift ist für alle Kunstsparten offen, das Kriterium ist also nicht das Genre, sondern die Aktualität. Und „mit anderen Augen“, weil die Meinung vorherrscht, die weißrussische Kultur sei veraltet, verschlossen für Modernes und Experimentelles – was ja auch nicht weiter verwunderlich ist: wenn man fernsieht, die offiziellen Medien liest oder sich ansieht, was der Staat an Kunst ausstellt, dann ist völlig klar, daß die offizielle Kultur hoffnungslos veraltet ist, nicht nur nicht aktuell, sondern sie hat gewaltige Schimmelflecken und ist mit einer dicken Staubschicht bedeckt. Und diese veraltete Kultur wird um die ganze Welt geschickt, zu Festivals, Ausstellungen, überallhin, wo es gilt, die weißrussische Kultur zu repräsentieren. Das gibt natürlich ein deprimierendes Bild ab. Wir wollen mit unserer Zeitschrift zeigen, daß die weißrussische Kultur sehr wohl modern ist, auf der Höhe der Zeit, daß sie offen ist für den Austausch mit anderen Kulturen und etwas hermacht auf dem internationalen Parkett. NARBUTOVIČ: Bislang sind vier Ausgaben von pARTisan erschienen. Welches waren die Themen? KLINAŬ: Im ersten Heft ging es um den Partisanen, im zweiten um das Spektrum von Demokratie, Kultur und Massenkultur, im dritten um Minsk als „Sonnenstadt der Träume“ – denn das architektonische Ensemble der im stalinistischen und spätstalinistischen Stil errichteten Paläste entlang des zentralen Prospekts von Minsk wirkt wie die gebaute Idealstadt der großen kommunistischen Utopie. Und im unlängst erschienenen vierten Heft von pARTisan war das Thema wie erwähnt „Urheber und Platz“. Jetzt sind wir gerade dabei, die beiden nächsten Ausgaben vorzubereiten, in denen es um die Themen „Krieg“ und „Dorf“ gehen wird. Im ersten wird es um kulturelle Kriege gehen, und zwar mit einem Akzent auf unserem östlichen Bruder und Nachbarn, also ein Heft zur kulturellen Expansion Rußlands, nicht nur in der heutigen Zeit, sondern auch in der Geschichte, es wird um die Folgen dieses Krieges gehen und darum, mit welchen Methoden man sich dagegen wehren kann. Und das zweite geplante Heft zum Thema „Zwischen Stadt und Dorf“ geht von der These aus, daß die Weißrussen keine dörfliche Bauernnation mehr sind, aber auch noch keine städtische, sondern irgendwo auf halbem Weg steckengeblieben sind. NARBUTOVIČ: Die weißrussischen Künstler sind vom europäischen Austausch ziemlich abgeschnitten. Besteht in dieser erzwungenen Isolation nicht die Gefahr, selbstreferentiell zu werden – wie es etwa bei der weißrussischen politischen Opposition der Fall ist, die nur noch um sich selbst kreist? KLINAŬ: Zum Glück ist die Situation im kulturellen Bereich weitaus besser. Was bei den oppositionellen Bewegungen in den letzten Jahren vor sich geht, ist nur noch befremdlich, ein Trauerspiel. Was die Kultur anbelangt, klar, da gibt es natürlich eine gewisse örtliche Beschränktheit. Aber dann gibt es noch ein ganz anderes Problem, nämlich daß es bei uns keinen normal funktionierenden Markt gibt. Die Mechanismen sind einfach nicht vorhanden: Es gibt keine Verlagslandschaft, ein Autor, der ein Jahr oder länger an einem Roman gesessen hat, muß sein Buch auf eigene Kosten drucken lassen; und es gibt in Minsk keine einzige Galerie. Das muß man sich mal vorstellen, Minsk ist eine Zweimillionenstadt! Ich habe in Minsk seit zehn Jahren keine Ausstellung mehr gehabt. Also stelle ich woanders aus, außerhalb von Belarus. Und so machen es viele Künstler. Die bildende Kunst hat es da viel einfacher als die Literatur, denn sie operiert mit einer Sprache, die allen sofort zugänglich ist. NARBUTOVIČ: Ihre Arbeiten sind voll von weißrussischen Themen – ich denke an die Kücheninstallation mit dem weißrussischen Sowjet-Retro-Kitsch, an die Installation, in der Sie ein komplettes Schlafzimmer aus Stroh gebaut haben, an den Fotozyklus zu Minsk als Sonnenstadt der Träume. So schwierig es ist, in Belarus zu leben, so anregend muß das Land in künstlerischer Hinsicht sein. KLINAŬ: Negatives kann durchaus anregend sein für die Kunst. Bei uns liegen die Themen sozusagen auf der Straße. In einem Land, in dem alles in Ordnung ist, nach einheitlichen Standards geregelt, in dem alles ist wie im Nachbarland – in dem wird womöglich auch die Kunst entsprechend aussehen. Jegliche Besonderheit ist eine gute Basis für ein Kunstwerk. So gesehen kann einem auch eine negative Eigenheit Anregungen geben für ein interessantes Kunstwerk. NARBUTOVIČ: Der Kulturwissenschaftler und Filmkritiker Maksim Žbankoŭ bezeichnet Sie als Pop-Art-Künstler und stellt Sie in eine Reihe mit Komar und Melamid, Andy Warhol und Viktor Pelevin. Pop-Art definiert er als eine Kunst, die Zeichen und Symbole der Massenkultur analysiert und mit Fragmenten ihrer Mythologie spielt. Fühlen Sie sich als Künstler mit diesen Worten zutreffend beschrieben? KLINAŬ: Ja, ich denke, Pop-Art ist der richtige Ausdruck. Ich bemühe mich immer darum, daß meine Werke auf mehreren Ebenen funktionieren. Vielschichtigkeit ist für mich wichtig, nicht nur in der Kunst, auch in der Literatur. Ausschließlich in Elitekreisen zu verkehren, das führt doch zur Isolation und in eine Sackgasse. Es macht keinen Sinn, sich darüber zu beklagen, daß die Massenkultur alles erdrückt und es für die E-Kultur keinen Platz mehr gibt. Es kommt darauf an, einen Weg zu finden, daß beides mit- und nebeneinander existiert. NARBUTOVIČ: Sie mischen in Ihren Kunstwerken gerne E und U, verbinden Themen der Hochkultur mit Gegenständen aus dem Alltagsleben. Was ist Ihr aktuelles Projekt? KLINAŬ: Immer noch Minsk als „Sonnenstadt der Träume“. Denn das Sonnenstadt-Projekt besteht für mich nicht nur aus dem Fotoband oder dem gerade bei Suhrkamp erschienenen Buch – es geht um die Schaffung eines Mythos und darum, das Projekt so bekannt zu machen, daß die Minsker „Sonnenstadt“ zu einer touristischen Größe wird, zu einem Markenartikel wie beispielsweise Venedig, Prag oder Paris. Wenn es gelingt, die Marke „Minsk als Sonnenstadt der Träume“ entsprechend zu lancieren, dann kann das mehrere Milliarden Dollar einbringen – nicht für mich, sondern an Geldern, die die Touristen nach Minsk mitbringen und dort ausgeben. NARBUTOVIČ: Kann es sein, daß Sie ein großer Mystifikator sind, begnadet mit der Begabung, schöne Legenden zu schaffen? KLINAŬ: Klar, das Projekt ist ein bißchen abenteuerlich (lacht), aber das schreckt mich nicht. Die „Sonnenstadt der Träume“ als touristisches Ziel so bekannt zu machen wie Venedig, das wird wohl kaum zu schaffen sein. Aber wenn es nur 15 oder 10 Prozent des Bekanntheitsgrades von Venedig wären, dann entspräche das genau den Milliarden Dollar, die ich eben erwähnt habe. Ich finde es auf jeden Fall als Projekt interessant. Und außerdem ist es ein sonniges, optimistisches Projekt, das gefällt mir auch. Denn Weißrußland ist so ein düsterer großer Sumpf – auch hierin ist eine der mystischen Ursachen für das Elend und die Ungereimtheiten bei uns im Lande zu suchen. Ich habe mir einfach eines Tages gesagt: Wenn du glücklich sein und Erfolg haben willst, dann sitz’ nicht im Sumpf rum, sondern halte dich an die Sonne. „Halte dich an die Sonne!“, diese Parole gefällt mir sehr. Und ich bin überzeugt davon, daß die „Sonnenstadt der Träume“ das Land aus dem Sumpf ziehen wird. NARBUTOVIČ: Und wie geht der Präsident mit dem Erbe der „Sonnenstadt“ um? Radiert er – wie so viele Herrscher zuvor – die Spuren der Vergangenheit aus und nimmt Minsk als Schiefertafel, die man nach eigenen Vorstellungen neu bemalen kann? KLINAŬ: Das ist in der Tat etwas, was ich befürchte. Bislang ist die „Sonnenstadt“ als städtebauliches Ensemble noch komplett erhalten, aber es ist jederzeit möglich, daß irgendwelche Hochhäuser oder pompösen Neubauten mitten in die „Sonnenstadt“ hineingepflanzt werden. Obwohl man sagen muß, daß die Staatsmacht manche Fragmente der „Sonnenstadt“ sogar saniert und rekonstruiert. Aber es gibt keine Garantie. Darum ist es ja gerade so wichtig, daß der Mythos schnellstmöglich greift und die Menschen die „Sonnenstadt“ als besonderes architektonisches Erbe annehmen, das es zu schützen gilt und auf das sie stolz sein können.
Volltext als Datei (PDF, 309 kB)